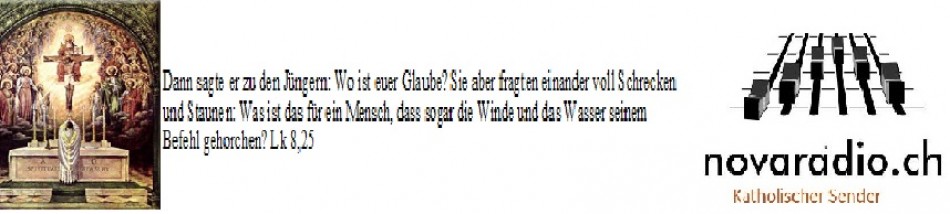Ein Essay von Daniel Ric
Vorwort zur Entstehungsgeschichte:
Das vorliegende Essay ist das Produkt einer Gesprächsreihe, in welchen die aktuellen Herausforderungen thematisiert wurden, denen sich Menschen stellen müssen, die eine christliche Anthropologie vertreten. In diesen Salongesprächen, an denen letztes Jahr Menschen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik mitgewirkt haben, wurde versucht, Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen zu geben. An zwei Abenden wurde die Gesprächsrunde durch Impulsreferate von Frau Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz bzw. Herrn Professor Peter Kirchschläger bereichert. In einer freien Reflexion versucht das vorliegende Essay, die vielen Erkenntnisse, die an diesen drei Abenden für den Verfasser des Textes gewonnen wurden, in einer für den Leser zusammenhängenden und hoffentlich nützlichen Form zusammenzutragen.
Einleitung
In einem wohl nie dagewesenen Ausmass stellen sich für den heutigen Menschen Fragen, deren Beantwortung früher nicht notwendig erschien oder eine Replik provozierte, die so fest auf den Grundlagen des damaligen Weltbildes fusste, dass jede weitere Diskussion schnell obsolet wurde. Der heutige Anspruch einiger gleichgeschlechtlicher Paare an die Gesellschaft, die Ehe neu zu definieren, das Begehren von Männern und Frauen, die Macht der biologischen Geschlechtsbezeichnung zu brechen, um das soziale Geschlecht selbst zu bestimmen und schlussendlich der bisher noch unerfüllte Wunschtraum einiger Technologie-Optimisten, durch ein sogenanntes „Human Enhancement“ die Grenzen dessen, was die Natur dem Menschsein vorgibt, stark zu erweitern bzw. diese Grenzen auszulöschen, wären noch vor einigen Jahrzehnten als provokante Gedankenspiele von exzentrischen Utopisten gebrandmarkt worden. Gerade die Tatsache aber, dass viele der heutigen Diskussionen vor Jahrzehnten noch
undenkbar gewesen oder mit keiner gesellschaftlichen Relevanz geführt worden wären, wirkt heute in zweierlei Hinsicht hemmend auf den Diskurs ein. Auf der einen Seite ist gerade im gesellschaftlichen Bereich eine grosse Lust der Individuen spürbar, Konventionen zu brechen. Diese Lust wird genährt durch den raschen technologischen Fortschritt, der vielen Menschen das Gefühl gibt, dass die Moral sich in gewissen Fragen genauso ändern und Neuerungen Platz machen muss, wie veraltete technologische Geräte dies neuen Erfindungen gegenüber tun müssen. Auf der anderen Seite ist gerade die Selbstverständlichkeit, mit welcher früher viele der Streitpunkte, die heute für Diskussionen sorgen, abgeschmettert oder gar nicht erst thematisiert wurden, ein Verhängnis für einen fruchtbaren Diskurs geworden. Wenn eine Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg ein bestimmtes Menschenbild und eine damit zusammenhänge Moral aufweist, gehen im Laufe der Zeit die Argumente vergessen, welche zu dieser Zementierung des Menschenbildes geführt hatten. Übrig bleiben schlussendlich nur noch jene moralischen Gebote und Verbote, welche von der heutigen Gesellschaft als antiquiert betrachtet werden. In der Schweiz steht die Katholische Kirche dieser Entwicklung bisher noch sehr hilflos gegenüber. Der historischen Tatsache bewusst, dass es das christliche Gedankengut ist, welches das heutige Menschenbild entscheidend geprägt hat, sieht sie sich einerseits als Hüterin dieser christlichen Anthropologie, währenddem sie auf der anderen Seite versucht, ihre Lehre nicht zu dogmatisch dem heutigen Zeitgeist entgegenzuschleudern. Das Ergebnis dieses Spagats ist die Tendenz, sich zu vielen brennenden Fragen nach aussen in Schweigen zu hüllen. Innerkirchlich führt diese Taktik zu einer Polarisierung innerhalb der Schweizer Katholischen Kirche, da dieses Schweigen unterschiedlichsten Interpretationen dienstbar gemacht wird. Weniger verwunderlich ist es dementsprechend, wenn ein sehr pointierter Bezug zu einschlägigen Stellen in der Bibel, welche die Homosexualität verurteilen, für einen Aufschrei oder einen grossen Beifall bei sogenannt progressiven bzw. sogenannt konservativen Katholiken sorgt. Der Zusatz „sogenannt“ vor den von den Medien stark verwendeten Beschreibungen geschieht in der Absicht, sich so nüchtern und unbelastet wie möglich diesen Fragen zu widmen und darauf zu verzichten, die eigene Position anhand des herrschenden Zeitgeistes – ob nun zugunsten oder
gegen ihn – zu definieren. Gerade in Fragen der Ehe, der Leiblichkeit und der Definition dessen, was der Mensch überhaupt ist und inwiefern er den technologischen Wünschbarkeiten unterworfen werden darf, ist die Katholische Kirche nur sehr beschränkt darauf angewiesen, sich der biblischen Offenbarung zu bedienen. Da die katholische Ethik sehr stark auf der Vernunft basiert und der Glaube nicht als Widerspruch zur Vernunft betrachtet wird, ist gerade in diesen Fragen die Fähigkeit der kirchlichen Vertreter gefragt, mit Argumenten den Diskurs zu beeinflussen, die der Allgemeinheit zugänglich sind, ohne dass die Texte des alten und neuen Testaments als Offenbarung akzeptiert werden müssen. Diesen mühsamen Weg, der nur begrenzt die Schützenhilfe der eingängigen Texte der Bibel in Anspruch nimmt, zu begehen, ist der Wunsch des folgenden Essays. Der Erfolg soll darin bestehen, die Fragen der Gefühlswelt zu entreissen und jene durch eine auf der Vernunft basierenden Betrachtung zu ersetzen, welche alle heute so brennenden Fragen der Polarisierung entzieht.
Ehe für alle
In vielen Ländern ist es mittlerweile zu einer Öffnung des Ehebegriffs gekommen, die es gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, ihre Beziehung als Ehe zu deklarieren. Der Jubel und die Euphorie, welche diese Gesetzesänderungen teilweise in den Medien und in der Zivilgesellschaft hervorgerufen haben, stehen in keinem Verhältnis zu den realen Auswirkungen, die dieser Öffnung folgen werden. Da nur ein kleiner Bruchteil der Gesellschaft in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebt und von diesem kleinen Bruchteil nur wenige Paare gewillt sind, ihrer Beziehung durch die Ehe einen neuen Status zu geben, scheint es auf den ersten Blick paradox, dass die „Ehe für alle“ in demokratischen Gesellschaften, welche die Interessen der Mehrheit unter Einbezug der Wünsche der Minderheiten wahren sollten, ein so grosses Echo erhält. Dies umso mehr, da die rechtliche Situation für Homosexuelle in vielen Ländern, die nun den Ehebegriff geöffnet haben, bereits vor der Gesetzesänderung nicht ungeordnet war, sondern oft durch den Status der
„eingetragene Partnerschaften“ eine bereits praktikable Lösung vorwies. Da der
öffentliche Diskurs oft sehr plakativ geführt wird und Begriffe wie
„Diskriminierung“ oder Parolen wie „gleiche Rechte für alle“ die Gefühle der Menschen stark bewegen, ist es oft schwierig, hinter Schlagworte und Parolen zu blicken und nüchtern zu analysieren, welche konkrete Verbesserung der Lebenssituation eine Gesetzesänderung für die Betroffenen mit sich bringt. Die
„Ehe für alle“ hat rein rechtlich keine Auswirkungen auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften, solange das Recht auf Ehe nicht auch das Recht beinhaltet, Kinder zu adoptieren. Für kinderlose gleichgeschlechtliche Paare hat die Neubenennung ihrer Beziehung rein symbolischen Charakter, der aber nichts an ihren individuellen und gemeinsamen Rechten ändert. Ohne diesen Wunsch moralisch zu verurteilen, muss festgehalten werden, dass es beim Begehren, die eigene Beziehung als Ehe zu deklarieren, oft darum geht, durch die Änderung von Definitionen bezüglich der Ehe sich der gesellschaftlichen Akzeptanz zu versichern. Die Hoffnung homosexueller Paare, dass bei einer ausgeweiteten Ehedefinition die Vorbehalte, die sie im Alltag erfahren, langsam schwinden werden, beruhen auf der Vorstellung, dass es die Sprache und das Recht sind, welche die Lebensumstände der Menschen prägen. Unterstützung erhalten sie dabei von all jenen Menschen, die in den überlieferten Rechten und Begrifflichkeiten ein antiquiertes Weltbild vermuten, dessen Revolutionierung grosse gesellschaftliche Veränderung bringen wird. Dies erklärt, weshalb die nur sehr geringe Prozentzahl der tatsächlich von diesen Gesetzen Betroffenen es schafft, solchen Gesetzesänderungen in der Demokratie Geltung zu verschaffen. Die kirchliche Position aus dieser verstaubten Ecke zu befreien, in die sie vom Zeitgeist der Mehrheitsgesellschaft gedrängt wird, bedingt eine Orientierung an der Frage, welchen Zweck die Ehe in der Gesellschaft überhaupt hat. Die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau zu einer von der Gesellschaft geschützten Einheit ist nicht eine von Menschen willkürlich gemachte Institution. Die etymologische Herkunft des Wortes „Ehe“, die Verbindungen zu den Begriffen
„Recht, Ewigkeit bzw. ewig geltende Gewohnheit“ hat, zeigt auf, dass es sich hier nicht um ein willkürlich vom Menschen geschaffenes Gebilde handelt, sondern um eine Regelung, die seit Jahrtausenden fester Bestandteil der Kultur ist. Weder das Judentum noch das sich aus dem Judentum entwickelte Christentum haben die Ehe als Institution geschaffen, sondern haben sie übernommen. Das populäre
Vorurteil, dass mit dem Schwinden des christlichen Einflusses auf die Gesellschaft auch die Moral eine völlige Neuorientierung braucht, kommt durch eine sehr radikale Negierung der historischen Entwicklung zustande. Auch wenn, wie Nietzsche dies dem Christentum vorgeworfen hat, das jesuanische Liebesgebot im Umgang mit den körperlich und geistig Schwachen, Behinderten und am Rande der Gesellschaft Stehenden sozialdarwinistischen Gedanken entschieden widerspricht, so darf nicht übersehen werden, dass die katholische Ethik im Naturrecht eingebettet ist. Die Heterosexualität als Bedingung für eine Ehe leitet sich daher für den Katholiken nicht primär aus der Genesis ab, sondern aus der biologischen Tatsache, dass die Generativität der Gesellschaft nur in einer Beziehung zwischen Mann und Frau möglich ist. Wer zusätzlich die Genesis als Quelle der Offenbarung akzeptiert, liest aus ihr heraus, dass diese Geschlechtlichkeit des Menschen gottgewollt und von Gott für gut empfunden ist, und dass die Einheit zwischen Mann und Frau keine hierarchische Unterordnung der Frau voraussetzt. Diese wohl im babylonischen Exil endgültig niedergeschriebene Offenbarung der damaligen Juden begründete weder die Ehe (noch die damals patriarchale Gesellschaft) , sondern wurde an eine Kultur gerichtet, welche die Ehe als Institution bereits seit Jahrtausenden kannte. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass in früheren Zeiten die sexuellen Präferenzen völlig anders als heute waren, sondern dass auch früher ein bestimmter Prozentsatz von Menschen homosexuelle, bisexuelle oder asexuelle Neigungen aufwies, wurde die Ehe nicht in einem Umfeld geschaffen und über Jahrtausende bewahrt, das frei von Menschen war, die aufgrund ihrer natürlichen Disposition nicht eine Ehe eingehen konnten. Dass diese Definition so lange Bestand hatte, obwohl sicherlich einige der Herrscher, Könige oder Autokraten, auf die sich die Macht der damaligen Gesellschaft zentrierte, nicht heterosexuell waren, wobei die Mehrheit der heutigen demokratischen Gesellschaften, die sich bereits aufgemacht haben bzw. noch aufmachen werden, die Ehe nicht nur auf gegengeschlechtliche Paare zu beschränken, sicherlich überwiegend heterosexuell ist, ist ein Phänomen, mit welchem sich die Politikwissenschaft und die Politik auseinandersetzen muss.
Nun ist die Tatsache, dass die Ehe historisch stets eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau definierte, noch kein absoluter Beweis gegen eine Öffnung
derselben für andere Beziehungen. Schlussendlich muss auch der überzeugte Christ eingestehen, dass in einer Gesellschaft, deren Mitglieder nicht eine Offenbarung als Richtschnur für ihr Handeln und die in der Gesellschaft geltenden Gesetze akzeptieren, sich auch Hinweise bezüglich eines Naturrechtes auf sehr dünnem Eis bewegen, da diese der Natur (bzw. deren Erschaffer) ein Telos unterstellen, dessen Entschlüsselung immer eine Interpretation des menschlichen Geistes bleiben wird. Das Einbringen der christlichen Position in dieser Frage sollte sich daher zuerst darauf konzentrieren, den Diskurs so geordnet und klar wie möglich zu gestalten. Dazu gehört beispielweise der Hinweis, dass es kulturgeschichtlich unhaltbar ist, die Öffnung der Ehe als fortschrittlich zu bezeichnen. Wenn die katholische Position trotz gewichtiger biologischer Argumente, was die Generativität der Gesellschaft betrifft, nicht für sich exklusiv in Anspruch nehmen darf, den Telos der Natur zu kennen, so darf auch keine Politik durch den Begriff „fortschrittlich“ suggerieren, auf das Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung hinzuarbeiten. Die Diskreditierung solcher Adjektive, welche den politischen Diskurs stark bestimmen, würde zu einer neuen Sachlichkeit führen. Des Weiteren wäre es der katholischen Position dienlich, die Menschen für die Erkenntnis zu sensibilisieren, dass es nur selten so ist, dass man eine Jahrtausende lang gewachsene Ordnung beliebig ändern kann, ohne die Institution als Ganzes infrage zu stellen. Die radikalen Systeme der Neuzeit, speziell die beiden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, mussten die Erfahrung machen, dass sich gesellschaftliche Änderungen nicht am Reissbrett vollziehen lassen, ohne Gefahr zu laufen, die ganze gesellschaftliche Ordnung zum Einsturz zu bringen. Es ist auffallend, wie leichtfertig von Ehe für alle gesprochen wird, ohne sich zu überlegen, wer „alle“ eigentlich sein könnten, wenn dieser Gedanke radikal zu Ende gedacht wird. Bisher war die Ehe der Schutz zweier Menschen, die als Frau und Mann in einen Bund eintraten. Diese positive Formulierung der Ehe wird bei einer Ausweitung auf homosexuelle Paare noch viel mehr den Vorwurf der Diskriminierung nach sich ziehen, wenn polygame oder platonische Beziehungen aus dieser Definition ausgeschlossen werden. Bei genauerer Betrachtung ist es ein Ding der Unmöglichkeit zu erklären, weshalb eine Ehe auf zwei Personen beschränkt werden solle.
Entweder ist diese Beschränkung auf zwei Personen einer ewigen Idee
geschuldet, die metaphysischen Ursprungs ist, oder der biologischen Tatsache, dass es zwei Menschen – Mann und Frau – benötigt, um ein Kind zu zeugen, oder es ist ein rein gesellschaftliches Konstrukt, das wandelbar ist. Da sich die Befürworter der „Ehe für alle“ nur schwerlich auf die ersten beiden Begründungen stützen können, müssen sie die dritte Position einnehmen, die aber eine Ausweitung des Ehebegriffs auf Beziehungen mit mehr als zwei Personen erlauben müsste. Hier liegt das Dilemma aller philosophischen Positionen, die gesellschaftliche Verhältnisse nur als Konstrukte betrachten, die den gerade herrschenden Machtverhältnissen in der Gesellschaft entsprechen.
Wenn keine religiöse oder naturrechtliche Autorität als Referenzgrösse akzeptiert wird, dann sind die gesellschaftliche Moral sowie die darin vorkommenden Institutionen wie beispielsweise die Ehe beliebig formbar. Es mutet daher komisch an, dass die Befürworter der Ehe für alle sich nicht die Frage stellen, weshalb überhaupt an der bürgerlichen Ehe festgehalten werden soll. Es wäre folgerichtiger, wenn diese Institution gänzlich abgeschafft würde, da man die Definition der Ehe, sobald sie einmal aus der religiösen oder kulturgeschichtlichen Tradition herausgerissen wird, nur schwer eingrenzen kann. Wie bei so vielen Fragen ist es auch in dieser Thematik so, dass man nur beim ersten Schritt frei ist, der zweite aber durch den ersten vorgegeben wird. Leider findet diese Tatsache bei den Befürwortern in ihrer Euphorie darüber, dass gesellschaftliche Konventionen gebrochen und traditionelle Wertvorstellungen ersetzt werden, keine Berücksichtung. Langfristig könnte sich dies für die Akzeptanz homosexueller Individuen negativ auswirken. Wurden im Laufe der Geschichte homosexuelle Beziehungen oft stillschweigend toleriert, obwohl man darin etwas Sündhaftes und dem göttlichen Willen Widersprechendes sah, so deswegen, weil man einerseits zwischen der Liebe für den Sünder und der Ablehnung der Sünde unterschied und andererseits gerade das Ideal der Ehe mit seiner Zweisamkeit auch eine gewisse Akzeptanz für Verbindungen ausstrahlte, die von der Gesellschaft als moralisch falsch betrachtet wurden. Diese auf den ersten Blick komisch anmutende Tatsache findet ihre Bestätigung anhand der Aussagen einiger Aufklärer, die gegenüber Homosexuellen eine viel stärkere Ablehnung und Verachtung zeigten, als es die Kirche tat. Die Aufrechterhaltung des Ideals einer Ehe zwischen Mann und Frau
ist nicht nur für heterosexuelle Verbindungen ein grosser Schutz, sondern auch für Verbindungen, die nicht diesem Ideal entsprechen, in denen man aber gewisse Elemente dieses Ideals verwirklicht sieht. Die Dekonstruktion dieses Ideals wird langfristig nicht der geschlechtlichen Verbindung schaden, auf die keine Gesellschaft verzichten kann, sofern sie überleben möchte, sondern wird vor allem in Zeiten eines wirtschaftlichen Niedergangs, unsicherer Sozialwerke aufgrund tiefer Fertilität und schwindenden internationalen Einflusses aufgrund der durch die tiefe Fertilität bedingten demographischen Stagnation gegen jene Verbindungen gerichtet sein, die aus einer utilitaristischen Sichtweise der Gesellschaft keinen Nutzen bringen.
Gender-Mainstreaming
Nur schon die Wahl eines geeigneten Untertitels für die nächste Thematik, die von der christlichen Anthropologie eine Stellungsnahme erfordert, zeigt die Schwierigkeiten auf, die beim Versuch einer adäquaten christlichen Positionierung entstehen. Die Emotionalisierung und Polarisierung, die mit den Begriffen Gender-Mainstreaming, Gender-Ideologie und Genderismus verbunden sind, machen es schwer für eine Katholikin und einen Katholiken, sich eine eigene Meinung zu bilden und später an der gesellschaftlichen Meinungsbildung mitzuwirken. Für eine nüchterne und sachliche Diskussion ist es daher unentbehrlich, zuerst einmal zu definieren, was man selbst unter Gender- Mainstreaming versteht. Ein Blick in Lexika, ins Internet und andere Medien offenbart eine Fülle von Definitionen, die aber oft das Wesentliche verschleiern. Der zentrale Begriff „Gender“, der allen vorhin verwendeten Wortkreationen zugrunde liegt, impliziert die Annahme, dass es sich beim biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht um zwei verschiedene Kategorien der menschlichen Identität handelt. Diese Unterscheidung, die in der deutschen Sprache nur durch die Verwendung des Anglizismus „Gender“ geschaffen werden kann, da die deutsche Sprache kein Äquivalent hierfür besitzt, suggeriert, dass das soziale Geschlecht nicht notwendigerweise durch das biologische Geschlecht vorgegeben wird. Diese Tatsache wird dem nicht in die
Tiefe der Materie eindringenden Beobachter oft nicht offenbart, da die gesellschaftlichen Ziele, die oft unter dem Schlagwort Gender-Mainstreaming subsumiert werden, sehr noble Anliegen beinhalten. Meistens wird darunter der Wunsch verstanden, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf allen Ebenen durchzusetzen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik, welche die intensive Lektüre der Schriften der Begründerinnen und Begründer dieser Denkrichtung erfordert, zeigt aber auf, dass hier vor allem die Kategorien „Mann“ und „Frau“ infrage gestellt werden. Eine der Hauptprotagonistinnen dieser Philosophie, Judith Butler, erachtet die Begriffe Mann und Frau als von der Gesellschaft geschaffene Konstrukte, die ihren Machtanspruch durch die Sprache zementieren. Den Poststrukturalismus bis ans Ende denkend, geht sie davon aus, dass die biologischen Unterschiede der Geschlechter nicht massgebend für die soziale Rolle sind, welche die Geschlechter in der Gesellschaft erfahren. Daher könnte die Bezeichnung „Mann“ auch für eine Person gelten, die nach unseren heutigen biologischen Massstäben eine Frau ist. Umgekehrt könnte eine mit männlichen Geschlechtsorganen ausgestattete Person als Frau bezeichnet werden. Judith Butler und ihre Anhängerinnen und Anhänger plädieren dafür, dass das biologische Geschlecht nicht über das soziale Geschlecht (Gender) bestimmen soll. Die Hoffnung, die sich hinter diesem Vorhaben verbirgt, besteht in der Annahme, dass die heutige Rollen – und Machtverteilung zwischen Mann und Frau sowie die Unfreiheit für die Individuen, die sich in ihrem biologischen Geschlecht unwohl fühlen, durch eine Aufhebung dieser Schranken beseitigt wird.
Gerade gläubige Menschen sind auf den ersten Blick sehr irritiert durch die These, dass es neben dem biologischen Geschlecht noch weitere Geschlechtsdefinitionen geben könnte, da sie den menschlichen Leib und die geschlechtliche Zuordnung als gottgewollt betrachten. Diese Irritation teilen sie mit Naturwissenschaftlern, die ebenfalls nur sehr schwer mit der Aussage zurechtkommen, dass die biologische Kategorisierung des Geschlechts durch eine geisteswissenschaftliche ersetzt werden darf. Die katholische Position muss, auch wenn sie schlussendlich diese Philosophie entschieden ablehnen muss, trotzdem eine sehr differenzierte Argumentation anwenden. Zuerst einmal ist allen Poststrukturalisten zuzustimmen, dass Sprache tatsächlich soziale
Verhältnisse deutet und damit auch beeinflusst. Es gibt keine Wirklichkeit, die nicht durch die Sprache oder zumindest die Mathematik, welche auch ein Produkt des menschlichen Geistes ist, vermittelt wird. Gerade die Theologie, die sich immer mehr vor der Deutung naturwissenschaftlicher Ergebnisse scheut, könnte sich vom Mut der Poststrukturalisten anstecken lassen, und vermehrt darauf hinweisen, dass die strikte Trennung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ein Zerrbild gesellschaftlicher Realität ist. Die Differenz zwischen Vertreterinnen und Vertretern des Gender-Mainstreaming und Anhängern der christlichen Anthropologie besteht in der Radikalität, mit welcher jegliche biologische Kategorien von den Ersteren abgelehnt werden.
Wenn auch Sprache Realität deutet und Realität schafft, so bezieht sich Sprache doch immer auf einen konkreten Sachverhalt, der von der Natur vorgegeben wird. Unsere Begriffe für die Unterscheidung von Männern und Frauen, Kindern und Erwachsenen, Kranken und Gesunden, etc. sind sicherlich nicht völlig der Willkür enthoben (da es immer Grenzfälle geben kann), aber sie gründen immer auf empirisch erfahrbaren Kategorien, die Allgemeingültigkeit beanspruchen. Es ist schwer vorstellbar, dass eine menschliche Kultur sich entwickeln kann, die den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht zur Kenntnis nimmt und diesen Unterschied durch ihre Sprache dementsprechend nicht verbalisiert. Nur schon die Sexualität, die bei den allermeisten Fällen sich auf das andere Geschlecht richtet, führt dazu, den Unterschied zwischen Mann und Frau wahrzunehmen.
Hier bietet wohl das Gender-Mainstreaming die grösste Angriffsfläche, da fast unbestreitbar ist, dass in der Natur bei Tieren wie bei Menschen die Sexualität auf das jeweils andere Geschlecht ausgerichtet ist. Wenn aber Wesen, die sich keiner Sprache bedienen, durch ihre Triebe auf das andere Geschlecht hin ausgerichtet sind, so lässt sich nur mit grosser Mühe die These aufrechterhalten, dass diese Unterschiedlichkeit eine rein sprachliche Konstruktion ist. Es ist daher folgerichtig, dass Vertreterinnen und Vertreter des Gender-Mainstreaming auch stark die Vorstellung bekämpfen, dass Heterosexualität die sexuelle Norm darstellt. Der Aufschrei, der teilweise von christlichen sowie muslimischen Eltern zu hören ist, wenn im Aufklärungsunterricht andere Formen der Sexualität als normal dargestellt werden, geht daher an der Wurzel des Problems vorbei. Anstatt ideologische Kämpfe auszutragen, inwiefern es moralisch richtig
oder falsch ist, unterschiedliche Sexualpraktiken als normal bzw. abnormal darzustellen, sollten sich religiöse Eltern rein wissenschaftliche Argumente nutzbar machen, indem sie den philosophischen Hintergrund dieses Aufklärungsunterrichtes, der im poststrukturalistischen Gender-Mainstreaming verwurzelt ist, infrage stellen.
Wenn die Bedenken gegen das Gender-Mainstreaming auf der theoretischen Ebene beiseitegeschoben würden und wir uns tatsächlich eine Kultur denken könnten, welche die Kategorien Mann und Frau nicht kennt, so stellt sich immer noch die praktische Frage, wem damit gedient wäre, wenn man versuchen würde, diese Kategorisierung in den Köpfen der Menschen rückgängig zu machen? Wie bereits weiter oben, im ersten Teilkapitel zur „Ehe für alle“, erwähnt, sind wir oft beim ersten Schritt frei, jedoch beim zweiten an die Konsequenzen des ersten Schrittes gebunden. Falls die kulturelle Entwicklung tatsächlich anders hätte verlaufen können, so muss doch akzeptiert werden, dass wir uns nun in einer Welt vorfinden, welche die Unterscheidung zwischen Mann und Frau aufweist und dass die Quantifizierung der Welt und des Menschen, die seit der Neuzeit massiv zugenommen hat, biologische Differenzen zwischen den Geschlechtern feststellt. Ob dies nun primäre oder sekundäre Geschlechtsmerkmale oder andere körperliche Attribute sind, es wird in unserer jetzigen auf Empirie angelegten Kultur ein Ding der Unmöglichkeit sein, Menschen davon zu überzeugen, dass die Unterschiedlichkeit der Geschlechter eine rein sprachliche Konstruktion ist. Hier liegt das Paradoxon des Gender- Mainstreaming: Es betrachtet sich als gesellschaftlich fortschrittlich, dies jedoch just zu einer Zeit, in der die Denkstruktur des modernen Menschen, der sein Wissen auf quantifizierbare Empirie gründet, ihm zuwiderläuft. Dieser Tatsache bewusst, versuchen seine Vertreter immer wieder Fälle für ihre Theorie in Anspruch zu nehmen, bei denen die Wissenschaft nicht eindeutig festlegen kann, ob es sich bei einer Person um einen Mann oder eine Frau handelt. Diese extrem seltenen Fälle, bei denen teilweise beide Geschlechtsmerkmale vorkommen, werden sehr häufig betont, um aufzuzeigen, dass eine Klassifizierung nicht alle individuellen Fälle abdeckt und dazu führt, dass Mediziner sich entscheiden müssen, ob sie der betreffenden Person dazu verhelfen, ein Mann oder eine Frau zu sein. Obwohl die heutige Genetik mit der Chromosomenanalyse meistens
ohne Willkür feststellen kann, ob es sich bei diesen seltenen Fällen um eine Frau oder einen Mann handelt, kann man eingestehen, dass die betroffenen Personen sicherlich darunter leiden, dass sie in einer Welt aufwachsen, bei denen die allermeisten Menschen sich ihres Geschlechts eindeutig bewusst sind, während sie dieses Bewusstsein nicht teilen können. Man kann auch eingestehen, dass es sicherlich auch Fälle gibt, bei denen zwar das Geschlecht einer Person eindeutig bestimmt ist, die Psyche es aber verunmöglicht, das eigene Geschlecht anzunehmen. Es entspricht nicht der christlichen Nächstenliebe, diese Fälle zu leugnen und die betroffenen Personen zu verurteilen. Trotzdem muss aber betont werden, dass es sich bei all diesen Phänomenen um so selten auftretende Fälle handelt, dass es fragwürdig ist, Gesetzgebung und Sprache deswegen zu ändern. Bei Letzterem ist auch die entscheidende Frage, inwiefern es überhaupt möglich ist, dass eine Änderung der Sprache auch die gewünschte soziale Veränderung bewirkt. Man kann der Behauptung, dass Sprache soziale Realität beeinflusst, zustimmen, ohne der Hybris zu verfallen, soziale Realität durch eine bewusste Änderung der Sprache bewirken zu können. Gerade die USA, welche Vorreiterin des politisch Korrekten ist, zeigt auf, dass in vielen Bereichen eine vermeintlich korrektere Sprache nicht eine soziale Änderung zur Folge hatte, sondern soziale Missstände nur kaschierte. Die soziale Lage der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA hat sich nicht dadurch verbessert, dass die Bezeichnungen für diese Gruppe in den letzten Jahrzehnten mehrmals abgeändert wurden. Gerade auch von Denkerinnen und Denkern, die dem Poststrukturalismus nahestehen, kommt daher immer stärker auch die Kritik an diesem „Political Correctness“ auf. Beim ganzen Wunsch, Diskriminierungen aufgrund der Sprache zu verhindern, ist vergessen gegangen, dass es die verbale Möglichkeit der Unterscheidung braucht, um auf Diskriminierungen aufmerksam zu machen. Wenn eine Frau nicht mehr das Wort Frau gebrauchen kann, um die Tatsache zu schildern, dass sie bei gleicher Leistung weniger verdient als eine männliche Person, die sie auch nicht als solche benennen darf, wird jede Benennung von Missständen eine Sache der Unmöglichkeit.
Gesellschaftspolitisch ist die Tendenz, dass sich Menschen nicht mehr gemeinsamen Kategorien zugehörig fühlen, problematisch zu werten. Demokratische Prozesse, in denen Gruppeninteressen formuliert werden,
beruhen darauf, dass sich Menschen nicht nur als Individuen sehen, sondern als Teil einer Gruppe. Die Auflösung jeder Kategorisierung führt schlussendlich zu einer Atomisierung der Gesellschaft, bei der sich vielleicht niemand durch Definitionen diskriminiert fühlt, jedoch auch niemand durch seine Gruppenzugehörigkeit gesellschaftliche Relevanz beanspruchen darf für seine Bedürfnisse und Ansprüche. Ohne einen konkreten Beweis, der über Vermutungen hinausgeht, dass die biologischen Kategorien nur ein sprachliches Konstrukt darstellen, sind die gesellschaftlichen Opfer, die durch die Umsetzung dieser Philosophie in Pädagogik, Gesetz und Sprache erbracht werden müssen, viel zu gross. Und ob gerade denjenigen Menschen, denen vermeintlich dadurch geholfen werden soll, tatsächlich ein Dienst erwiesen wird, ist ebenfalls mehr als fraglich. Ohne dass gleiche Denkexperiment wie bei den Ausführungen zur „Ehe für alle“ durchzuführen, soll einfach der Hinweis gemacht werden, dass es gerade die jetzige Sprache ist, welche jedem Menschen eine Würde jenseits seiner biologischen Qualität und gesellschaftlichen Nutzbarkeit zugesteht. Es ist eine falsche Sicherheit, in die sich die Befürworter der Zersetzung der heutigen Sprache zugunsten vermeintlich politisch korrekteren Varianten wiegen.
Langfristig könnten die zentralen Elemente der heutigen Sprache, welche allen Menschen einen grundsätzlichen Schutz bieten, zerstört werden.
Die Politik muss sich der Frage stellen, wie sie auf diese Entwicklung einwirken soll. Millionen von Franken fliessen an Lehrstühle, die sich den Gender Studies widmen und damit diese Philosophie fördern. Auch wenn sicherlich die Freiheit der Forschung und Lehre gewährleistet werden muss, bleibt die Frage im Raum, inwiefern der Steuerzahler eine Disziplin fördern muss, die nicht auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Die Schaffung eigener Studiengänge und Lehrstühle enthob die poststrukturalistischen Gender Studies der Konkurrenz anderer philosophischer Strömungen und brachte ihr eine gesellschaftliche Relevanz, die nicht gerechtfertigt ist bzw. über welche die philosophische Fakultät entscheiden muss. Die Freiheit der Forschung und Lehre wäre ebenfalls gewährleistet, wenn die Gender Studies keinen separaten Studiengang, sondern eine Richtung bzw. Thematik innerhalb des philosophischen Studienganges darstellen würden. Es muss für den Bürger sichtbar sein, dass es bei den Gender Studies nicht primär um den Wunsch geht,
die Gleichstellung zwischen Mann und Frau voranzutreiben, sondern um eine philosophische Strömung. Wie weiter oben angedeutet, steht diese philosophische Strömung im Widerspruch zur extremen – und sicherlich auch kritikwürdigen – Affinität zur Empirie, welche die heutige Wissenschaft aufweist. Würden die Gender Studies und ihr geistiges Produkt, das Gender- Mainstreaming, keine finanzielle und institutionelle Unterstützung erhalten, wäre der gesellschaftliche Einfluss sicherlich geringer. Auch wenn sich dieses Gedankengut auch schon stark in der Pädagogik und anderen Sozialwissenschaften verankert hat, so wäre es doch ein wichtiger Schritt, dass der Staat nur jenen akademischen Bemühungen finanzielle Mittel zuspricht, die rigoros die Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien befolgen. Abgesehen vom staatlichen Versagen, hier eine Korrektur erfolgen zu lassen, ist es aber auch ein Armutszeugnis für die wissenschaftliche Kultur der Schweiz sowie anderer westlichen Länder, dass alle akademischen Disziplinen sich so stark auf das eigene Fachgebiet und die Angst, sich gegenüber anderen Gebieten zu exponieren, fixiert sind, dass keine grossangelegte Kritik an den Gender Studies erfolgt. Wie in diesem Teilkapitel erörtert, muss und darf diese Kritik keinen vernichtenden Charakter haben, aber doch aufzeigen, dass viele Voraussetzungen und Schlussfolgerungen dieser Philosophie mit grosser Vorsicht zu geniessen sind.
Transhumanismus
Ein Grundanspruch, der den vorangegangen beiden Themen immer wieder unterschwellig bei den Befürwortern der „Ehe für alle“ oder des Gender- Mainstreaming zugrunde liegt, ist derjenige nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung. Die Autonomie des Menschen soll weder durch religiöse Vorschriften noch durch biologische Vorgaben eingeschränkt werden. Die Popularität dieser Gedanken, obwohl sie in vielen Fällen nicht auf rationalen Argumenten beruhen, erklärt sich wahrscheinlich in erster Linie durch die Hoffnung vieler Menschen, die seit dem 18. Jahrhundert fortschreitende Befreiung des Individuums dadurch weiter zur Entfaltung zu bringen. Daher auch immer wieder die Verwendung und Inanspruchnahme des Begriffs
„fortschrittlich“ oder „progressiv“, um klarzumachen, dass man sich dieser auf individuelle Freiheit setzenden Tradition verpflichtet fühlt. Für die Kritiker dieser gesellschaftlichen Veränderungen ist es dagegen schwierig aufzuzeigen, dass es nicht darum geht, Menschen Rechte und Freiheiten zu verwehren, sondern die Grenzen zu definieren, in welchen sich die menschliche Kultur bewegen kann, ohne dass das ganze Gefüge auseinanderzubrechen droht.
Geistesgeschichtlich war es wohl eine zu euphorische und nicht genaue Interpretation dessen, was Kant unter der Autonomie des Willens verstanden hat, die zu dieser sich immer stärker radikalisierenden Vorstellung von individueller Freiheit, samt den aus ihr resultierenden politischen und gesellschaftlichen Forderungen, geführt hat. Auch wenn man den aus dem Griechischen stammenden Begriff mit Eigengesetzlichkeit oder Selbstgesetzlichkeit übersetzen kann, so meinte und meint Autonomie im rechtstheoretischen Sinne keine schrankenlose Selbstbestimmung, sondern die Selbstverwaltung einer Körperschaft innerhalb eines grösseren Gebietes. Auf den Willen des Menschen bezogen, kann Autonomie daher nicht bedeuten, dass der menschliche Willen die eigene Existenz beliebig gestalten kann, sondern dass seine Macht nur innerhalb einer bestimmten Sphäre Einfluss hat. Die Etablierung des bürgerlichen Rechtsstaates mit seinen Freiheitsrechten hat nicht zur Folge gehabt, dass dem menschlichen Willen keine Schranken mehr gesetzt sind, sondern dass der Wille eine für ihn berechenbare und der Willkür enthobene Ordnung vorfindet. Zwei Schranken bleiben für den Menschen immer vorhanden: Die erste ist der Wille des Mitmenschen, der den eigenen Zielen zuwiderlaufen kann, die zweite ist der eigene Leib, die menschliche Natur.
Währenddem der Totalitarismus des 20. Jahrhunderts versucht hat, die erste Schranke durch eine Volksgemeinschaft bzw. Klassengemeinschaft, in welcher der kollektive Wille die vielen individuellen Willen ersetzt, zu überwinden, versuchen die in diesem Essay dargestellten geistigen Strömungen die zweite Schranke zu durchbrechen.
Den extremsten Versuch diesbezüglich stellt der Transhumanismus dar. Der Traum, die conditio humana durch ein „Enhancement“ des Menschen zu überwinden sowie die künstliche Intelligenz zu nutzen, um die menschliche Existenz völlig zu revolutionieren, ist eine Vorstellung, die nicht nur in Science-
Fiction Romanen Eingang gefunden hat, sondern immer mehr auch von seriösen Wissenschaftlern, Politikern und Philosophen thematisiert wird. Von der Vorstellung, dass der Mensch durch Implantate seine Lebenszeit massiv verlängern kann, bis zum Glauben, dass unser Geist in einer „Cloud“ gefasst wird, die uns den Beschränkungen des Leibes entreisst, sind verschiedene Utopien bezüglich den Verheissungen der Technologie hör- und lesbar. Unter diesen Wünschbarkeiten gesellt sich auch die Dystopie, dass mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Systeme dem Menschen weit überlegen sein werden und dann folgerichtig seine Vernichtung anstreben.
Theologisch sind all diese Utopien und Dytopien sehr interessant, da oft Hoffnungen und Ängste eine Rolle spielen, die dem christlichen Gedankengut entstammen. Der Wunsch nach ewigem Leben oder die Angst, dass die Natur – sei es auch eine von Menschenhand umgeformte bzw. programmierte – den Menschen beherrscht, sind jüdisch-christliche Motive und berühren eschatologische Fragen. Vor allem auf die letzte Angst, dass künstliche Intelligenz der letzte Schritt in eine Entwicklung darstellt, die der Mensch nicht mehr kontrollieren kann und die ihn der eigenen Vernichtung preisgibt, müssen christliche Denker eine entschiedene Antwort geben. Diese Antwort muss mit der Feststellung beginnen, dass es eine fast schon negative Korrelation gibt zwischen der Anzahl Aufsätze, Bücher und Thesen, die allesamt die baldige Dominanz der „Maschine“ gegenüber dem Menschen verkünden, und den Versuchen einer Definition, was der Mensch samt seinem Geist und seiner Intelligenz ist. Die wirkliche Klärung, was den Menschen zum Menschen macht, konnten bisher alle Biologen, Chemiker, Physiker sowie Psychologen nicht darbringen. Der Geist des Menschen, mit seiner Potenz sich selbständig Ziele zu setzen, Wertungen vorzunehmen und über sich selbst zu reflektieren, bleibt für den Menschen ein Mysterium. Wird der hochtrabende Begriff künstliche Intelligenz dem Diskurs entzogen und dadurch erzwungen, genau zu erklären, inwiefern sich die heutige Technologie fundamental vom früheren Gebrauch unterscheidet, so stellt sich schnell eine gewisse Ernüchterung ein. Sicherlich ist es beeindruckend, wie Schachcomputer Grossmeister schlagen und wie die Spracherkennung im Alltag Hilfen leistet. Genauso beeindruckend musste es aber auch für Menschen früherer Zivilisationen gewesen sein, als man Ochsen
eingespannt hat, um das Pflügen des Ackers zu erleichtern. Mit dem Unterschied aber, dass – soweit uns dies bekannt ist – wohl bei diesen Menschen keine Angst vorherrschte, dass der Pflug sich mit dem Ochsen verbinden wird, um den Menschen eliminieren oder beherrschen zu wollen. Die Angst, die heute rund um die Frage entsteht, ob die von den Menschen entwickelte Technologie diesen beherrschen wird, lässt sich durch einen Anthropomorphismus erklären, der auch im Diskurs in der Tierethik das darin verwendete Vokabular prägt.
Maschinen wie Tieren werden vermehrt menschliche Eigenschaften zugesprochen und der Diskurs verläuft anhand von Kategorien, die eigentlich nur auf Menschen anwendbar sind. Währenddem es richtig ist, dass die Ethik des Menschen gegenüber dem Tier nicht nur anhand der in der Tierwelt herrschenden Moral gemessen wird, sondern sich menschlicher Kriterien bedient, ist in Bezug auf die unbeseelte Natur grösstenteils ein wahrhaft unsinniges Vokabular feststellbar. Das Adjektiv „unsinnig“ ist hier bewusst gewählt, da bisher keinerlei Beweise vorliegen, dass ein computerbasiertes System, welches durch den Menschen geschaffen wird, sich selbst einen Sinn geben und Werte setzen kann. Daher ist der einzige Sinn, den die Maschine hat, derjenige, welcher der Mensch in ihr sieht. Formulierungen wie „Macht der Maschinen“ oder „Herrschaft künstlicher Intelligenz“ machen aus geisteswissenschaftlicher Perspektive keinen Sinn, da Macht und Herrschaft Begriffe sind, die in einem menschlichen Kontext ihre Sinnhaftigkeit entfalten.
Sogar bei Tieren, deren Wollen durch einen Trieb gelenkt wird, sind diese Begriffe deplatziert. Es ist die im Kapitel zu Gender-Mainstreaming benannte schmerzliche Trennung der Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, hier vor allem auch der Theologie, die es verunmöglicht, diese Sachverhalte klarer zu betonen. Sogar wenn Neurowissenschaftler die These aufstellen, wonach der Mensch auch Kausalitäten unterworfen ist, welche die Vorstellung einer Willensfreiheit zunichtemachen, lässt sich fragen, inwiefern diese These wirklich bewiesen werden kann, ohne die Funktionsweise des menschlichen Geistes als Ganzes zu verstehen, und inwiefern sogar ein Beweis dieser These einen grossen Unterschied für das Selbstverständnis des Menschen ausmachen würde. Auch wenn alle menschlichen Handlungen präzise vorausgesagt werden könnten, hätte der Mensch doch die Fähigkeiten, sich diese als frei vorzustellen und über
seine eigenen Handlungen zu reflektieren. Da es mehr als unwahrscheinlich ist, dass alle menschlichen Handlungen prognostiziert werden können, stellt die Aussage, wonach die menschlichen Handlungen durch Hormone, Nervenenden, Lebensumstände, etc. bestimmt werden, nichts anderes als eine in naturwissenschaftlicher Terminologie gekleidete Prädestinationslehre dar, die über Augustinus hin zu Luther und in radikaler Form bei Calvin immer wieder in der europäischen Geistesgeschichte Eingang fand. Die Popularität, welche die Prädestinationslehre sowie die heutigen Theorien zur künstlichen Intelligenz geniessen, entstammen wohl oft der gleichen Motivation. Die Last der menschlichen Existenz, eigene Entscheide zu fällen und diese vor sich rechtfertigen zu müssen, sowie das Wissen, dass die eigenen Entscheide das eigene und das Schicksal anderer Menschen beeinflussen, lässt sich durch die Vorstellung einer biologischen Vorherbestimmung oder der Delegierung der moralischen Verantwortung an Maschinen ablegen. Wenn bei der Rekrutierung von Personal, bei Entscheidungen am Finanzmarkt und sogar bei ganz intimen Fragen wie der Partnerwahl auf Algorithmen zurückgegriffen werden kann, dann ist die Frage, ob die dabei getroffene Wahl besser wäre, als wenn man auf diese computerbasierten Hilfsmittel verzichtet hätte, zweitrangig gegenüber der Tatsache, dass man die Bürde der Entscheidung nicht mehr selbst tragen muss.
Technologie-Optimisten mögen behaupten, dass diese Art der Entscheidungsfindung vor allem die Willkür, welche dem Menschen inhärent ist, ausgeschlossen wird. Aber auch hier hilft ein Blick in die Etymologie, um diesen Gedankengang besser zu verstehen und einordnen zu können. Willkür bedeutet im ursprünglichen Sinne die Entscheidungsfreiheit, ohne Sachzwänge handeln zu können. Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt und sein Überleben gesichert sind, erscheinen all seine weiteren Betätigungen in dem Sinne willkürlich, da sie aufgrund von Zielen erfolgen, die er sich selbst setzt. Die Rechtfertigung von Entscheidungen mittels Algorithmen verschleiert die Tatsache, dass diese Algorithmen der Erreichung von Zielen dienen sollen, die von einzelnen Menschen definiert wurden. So wird der über 60-Jährige Bewerber für eine Stelle, das wenig rentable, dafür aber sichere Wertpapier und die nicht dem BMI-Idealmass entsprechende Dame nicht deswegen aus der engeren Auswahl ausgeschlossen, weil objektive Kriterien dies verunmöglichen,
sondern weil die Vorgaben dementsprechend in das System eingespeist wurden. Hier liegt das Problematische an den Vorstellungen, die mit dem Begriff künstlicher Intelligenz verbunden sind. Er suggeriert, dass die neue Technologie eine höhere Objektivität schaffe, die das Subjektive des Menschlichen übersteigt. Die obigen Beispiele offenbaren den Unsinn solcher Vorstellungen. Auch die Ansammlung Milliarden von Daten, die mittels Big Data verarbeitet und ausgewertet werden, erreichen nicht eine höhere Form der Wahrheit, sondern nur eine gezielte Analyse von Eingaben, die auf subjektiven Werturteilen beruhen. Ob mir nun auf Facebook oder anderen sozialen Medien Vorschläge betreffend meiner zukünftigen Ferien gemacht werden, die auf Algorithmen basieren, welche mein Internetverhalten sowie die Auswahl der Feriendestinationen von sozio-ökonomisch ähnlich gelagerten Menschen untersuchen, oder ich einfach meinen Nachbarn nach einem Tipp frage, beeinflusst vielleicht die Qualität der Feriendestination, aber nicht die Qualität der Entscheidung als solchen. Es ist immer noch an mir, diese Entscheidung und die anschliessenden Ferien sinnstiftend in meine eigene Lebensgeschichte einzuordnen. Die Tendenz, dass Menschen ihre Entscheide immer mehr von Algorithmen, sozialen Plattformen und Ratingseiten wie TripAdviser beeinflussen lassen, basiert auf einer ideelen Überhöhung des Mehrheitsprinzips, das zwar im demokratischen Gemeinwesen die Gleichberechtigung der Bürger und gewaltlose Wechsel der Regierung ermöglicht, jedoch in Bezug auf individuelle Entscheide zu einem Konformismus und fehlendem Mut führt, eigene Lebensziele zu wählen. Diese Delegierung der eigenen Wahl an computerbasierte Systeme führt zu einer moralischen Verantwortungslosigkeit, die zu einer Abstumpfung ethischer Empfindsamkeit führt. Die fortschreitende Vermassung der Gesellschaft, dies nicht nur in ihren extremen Ausprägungen wie im Nationalismus, Nationalsozialismus und Kommunismus, sondern auch in den liberalen Industriegesellschaften, hat den
Einzelnen oft von der Last befreit, sich für seine eigenen Entscheide rechtfertigen zu müssen. Diese zunehmende Verantwortungslosigkeit des Menschen findet nun in der Vermenschlichung und Überhöhung bis hin zur Apotheose der Maschine ihre Grundlage, dem Höhepunkt dieser Entwicklung zuzustreben.
Gesellschaftlich und sozialpolitisch kann eine solche Entwicklung gravierende
Folgen haben. Entlassungen in der Exportindustrie aufgrund eines stärkeren Frankens, Outsourcing grosser Produktionsanlagen in Billiglohnländer sowie die Nichtgewährung von Krediten an Kleinunternehmer können nun allesamt damit gerechtfertigt werden, dass Computermodelle keine andere Entscheidungen als mögliche Variante zulasssen. Relevant ist hierbei nicht, ob solche Entscheide richtig oder falsch sind, sondern dass diese Entscheide gesichtslos vonstattengehen und nicht aufgezeigt wird, inwiefern normative, vom Menschen eingespeiste Vorgaben die Entscheide herbeiführen. In einer sterilen Weise wird dadurch versucht verborgen zu halten, dass fast alle menschlichen Entscheide Dilemmata darstellen. Bei den oben genannten Beispielen bestehen diese Dilemmata darin, dass der Unternehmer oder Manager abwägen muss, inwiefern er einerseits den Gewinn der eigenen Unternehmung maximieren, den langfristigen Fortbestand der Unternehmung sichern und die Interessen einzelner Anspruchsgruppen schützen kann. Die Illusion, ein solches Dilemma rational lösen zu können, ohne dass kritische Rückfragen Dritter oder des eigenen Gewissens auftauchen, stellt eine Selbstlüge bzw. ein Belügen der Gesellschaft dar. Es wäre eine Aufgabe katholischer Theologen und Denker, vermehrt auf diese gesellschaftliche Illusion aufmerksam zu machen und dadurch gerade den Schwächsten der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, wieder reale Personen und deren Zielsetzungen kritisch zu hinterfragen. Es ist absolut paradox, dass es gegenwärtig eine poststrukturalistische Theorie schafft, eine Theorie in den Köpfen der Menschen zu festigen, wonach die Kategorien Mann und Frau nur ein sprachliches Konstrukt sind, währenddem es die katholische Kirche mit ihrer 2000-jährigen Reflexion über das Wesen des Menschen es nicht vermag, das Vokabular der heutigen Technologie-Optimisten zu dekonstruieren und damit die Macht- und Ohnmachtsverhältnisse, die auf diesem Vokabular aufgebaut werden, anzugreifen. Die Kirche muss aufzeigen, dass hinter allen Entscheidungen, stets Ziele von Menschen stehen und die Euphorie, mit der Begriffen wie künstliche Intelligenz und Transhumanismus begegnet wird, eigentlich nichts anderes als der Wunsch ist, die Würde der menschlichen Verantwortung abzugeben. Wenn die Katholische Kirche aufgrund ihres Festhaltens an der Willensfreiheit vor 500 Jahren die Spaltung des westlichen Christentums in Kauf genommen hat, ist es kulturgeschichtlich
unverständlich, wenn sie nun nicht dem Zeitgeist entgegentritt und mit noch stärkerer Vehemenz die Freiheit des Willens verteidigt und dort benennt, wo diese Freiheit sich hinter technischen Begriffen versteckt und damit den Schwächsten der Gesellschaft die Möglichkeit nimmt, Missstände an konkreten Entscheiden von konkreten Personen festzumachen.
Wenn hier der Gedanke formuliert wird, dass der Hoffnung, die sich an den Begriff künstlicher Intelligenz klammert, eigentlich der Wunsch zugrunde liegt, sich moralischer Verantwortung zu entziehen, dann ist dieser Wunsch auch bei der Bestrebung vorhanden, das menschliche Leben durch Implantate ins Unendliche zu verlängern. Es muss bei dieser Diskussion gleich zu Beginn unterschieden werden zwischen der Nutzung technischer Möglichkeiten, das Leben qualitativ zu verbessern und dem radikalen Versuch, die Beschränkungen der Biologie gänzlich aufzuheben. Beim Versuch, das Leben qualitativ zu verbessern, ist es schwierig genau abzugrenzen, an welchem Punkt ethische Bedenken auftauchen. Bereits eine Zahnprothese, deren Nutzung wohl kaum Anlass für Kritik gibt, stellt einen künstlichen Eingriff dar, bei dem die Technologie zugunsten des Menschen genutzt wird. Die Grenze, welche sinnvolle Eingriffe von denjenigen Eingriffen scheidet, die aus ethischer Perspektive problematisch sind, wird wohl vor allem auch dort verlaufen, wo wirklich eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob der Eingriff zumindest mittelfristig dem Patienten einen Nutzen bringt. Wenn beispielsweise einer bereits todkranken Person, die nur noch wenige Wochen zu leben hat, noch ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird, stellt sich die Frage, inwiefern dies wirklich die Lebensqualität der Person erhöht. Da die Bestimmung dieser Grenze zwischen sinnvollen- und sinnlosen Eingriffen den Ärzten und den hierfür eingesetzten Kommissionen überlassen werden muss, soll im Folgenden vor allem der in Science-Fiction Romanen und im Silicon Valley beliebte Gedanke diskutiert werden, die Endlichkeit des Lebens durch technische Eingriffe gänzlich aufzuheben. Die Frage, ob dieser Wunsch überhaupt jemals real werden könnte, steht nicht im Zentrum dieser Analyse. Auch wenn es bisher keinen Anhaltspunkt für eine mögliche Realisierung solcher Träume gibt, ist es aus philosophischer und theologischer Perspektive wichtig, sich nur schon mit den Wünschbarkeiten, die dahinter stehen, auseinanderzusetzen. Gerade in der
westlichen Welt, in der immer weniger der Gedanke eines ewigen Lebens, den das Christentum verspricht, präsent ist, scheint dieser Gedanke nun in den technologischen Fantasien seinen Platz einzunehmen. Der Unterschied zwischen der christlichen Vorstellung ewigen Lebens und derjenigen der Technologie- Optimisten, besteht darin, dass der Christ sich die Ewigkeit zeitlos und nicht endlos vorstellt. In der Gemeinschaft mit dem unbewegten Beweger, der aus seiner Liebe heraus den Menschen geschaffen hat, lösen sich die Kategorien von Raum und Zeit auf, die heute unsere menschliche Existenz prägen. Die Utopisten des Silicon Valleys hingegen können sich nur erträumen, die Kategorie Zeit auf ein unbeschränktes Mass auszudehnen. Wenn wir aber den Gedanken, der vorhin bei der Frage rund um die künstliche Intelligenz vorherrschend war, wonach die Propagierung derselben vor allem dem Umstand zu verdanken ist, dass die menschliche Zivilisation sich der moralischen Verantwortung entledigen möchte, weiterverfolgen, so liesse sich auch beim Glauben an ein durch die Technik ermöglichtes ewiges Leben eine ähnliche Motivation herauslesen. Die eschatologischen Antworten des Christentums, sofern die konfessionelle Ausrichtung nicht eine radikale Form der Prädestination vertritt, führen den Menschen in eine Ewigkeit, die er mit seinen Handlungen, die er zu Lebzeiten begangen hat, betritt und die Bewertung seiner Handlungen Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit anvertrauen muss. Die Hoffnungen auf die Technologie statt auf den Glauben zu setzen, ist gleichzusetzen mit dem Wunsch, die moralischen Handlungen des Menschen von der Frage nach der Möglichkeit unendlichen Lebens zu entkoppeln. Für den Christen, der an einen allmächtigen Gott glaubt, der den Menschen von Anbeginn an in den Zustand der Zeitlosigkeit hätte versetzen können, wenn es seinem Plan entsprochen und mit der menschlichen Willensfreiheit (und damit seiner Würde als Person) vereinbar gewesen wäre, ist es fast undenkbar, diese Entkoppelung von individueller Moral und Ewigkeit zu vollbringen. Hier ist daher der Glaube an die Technik in einer geistesgeschichtlichen Tradition zu sehen, die über radikale Formen der Reformation hin bis zu deterministischen Geschichtstheorien die individuelle Verantwortung des Menschen leugnen und abschaffen wollen.
Es stellt sich aber die Frage, was gewonnen würde durch eine sehr starke oder sogar unendliche Verlängerung der menschlichen Existenz? Es ist klar, dass für
den einzelnen Menschen alle existentiellen Fragen, Freuden und Qualen in irgendeiner Form mit seiner Endlichkeit zusammenhängen. Unser ganzes Denken und Fühlen basiert auf dieser Endlichkeit. Auch eine sehr starke Zunahme dieser Lebensspanne würde diese Grundfesten unserer Existenz objektiv nicht verändern. Das einzige Resultat wäre das, was wir bereits heute in einer Zeit beobachten können, in welcher der Tod aus dem öffentlichen Raum verschwunden ist und die lange Lebensspanne der Menschen ihn auch aus dem Denken verbannt hat. Es tritt eine Verflachung und geringere Intensität des Lebens ein, bei welcher die Angst des Menschen, dieses unendlich scheinende Leben verlieren zu können, seinen Willen lähmt, dieses Leben mit Sinn zu füllen. Nur aus Erzählungen ist zu erahnen, wie intensiv jede Sekunde der eigenen Existenz gespürt worden ist, als der Mensch durch Krankheiten, Seuchen und Kriegen ständig vor die Tatsache gestellt wurde, dass diese Existenz bald ein Ende finden könnte. Auch wenn niemand von uns die äusseren Umstände zurückbringen möchte, welche diese Intensität begünstigt haben, muss es Angst machen, wie viel von dieser Intensität bereits nach einem Jahrhundert des Massenwohlstandes verloren gegangen ist. Leere Kirchen und das Desinteresse an philosophischen sowie theologischen Fragen sind genauso ein Symptom dieser fehlenden Intensität und des Bewusstseins, dass jedes Leben sich innerhalb zeitlicher Schranken bewegt, wie Gesundheitsratgeber, die ihren Lesern ein möglichst gesundes und damit langes, aber leider kein genussreiches Leben in Aussicht stellen. Solange die Wissenschaft nicht beweisen kann, dass es tatsächlich eine Hoffnung gibt, dass das menschliche Leben zukünftig beliebig lange verlängert werden kann, lässt sich unserer heutigen Zeit schwer attestieren, dass sie es besser versteht zu leben, als dies frühere Kulturen gekonnt haben. Und sollte tatsächlich der bisher völlig in den Sternen stehende Durchbruch erfolgen, der unendlich langes Leben ermöglicht, so stellt sich die Frage, ob in der jetzigen geistigen Verfassung unsere Gesellschaft wirklich einen Nutzen aus dieser Revolution ziehen könnte oder die Sinnlosigkeit der eigenen Existenz, welche bereits jetzt vielen Menschen zu schaffen macht, die keine metaphysischen Wahrheiten akzeptieren, nicht einfach ins Unendliche gesteigert würde.
Schlusswort
Im ganzen Essay wurde fast vollständig darauf verzichtet, biblische Texte für die Argumentation zugunsten einer christlichen Anthropologie heranzuziehen. Wie einleitend geschildert, geschah dies in der Absicht, die Akzeptanz der hier dargelegten Argumente nicht vom Glauben an die Texte des alten und neuen Testaments abhängig zu machen. Zumindest im Schlusswort soll aber das Bekenntnis Platz erhalten, dass meiner Meinung nach die biblischen Texte sehr viel Aussagekraft für die heutige Zeit besitzen. Nur schon die Genesis, der Schöpfungsbericht der Juden und Christen, bei dem viele Elemente auch im Koran wiederzufinden sind, gibt viele Antworten auf die hier gestellten Fragen. Der Bericht eines Menschen, der aus dem Boden entnommen wurde, und auch zu diesem zurückkehren wird, ist eine Absage an alle Vorstellungen, wonach der Mensch von seinem Leibe getrennt werden könnte. Die Aussage Gottes, dass er alles, was geschaffen wurde, sah und für gut empfand, ist die Absage an alle (neu)-gnostische Verdammung des Leibes und damit auch der Geschlechtlichkeit. Diese Texte stellten und stellen immer noch für leibesfeindliche Theologie-Ausprägungen innerhalb der Katholischen Kirche eine Schranke dar. Die Aussagen der Genesis stellen aber auch eine Schranke dar für eine sich selbst als progressiv bezeichnende Theologie, welche die Geschlechtlichkeit als reinen Selbstzweck betrachtet, der nicht dem göttlichen Heilsplan untergeordnet ist. Wenn jeder Mensch ein Gedanke Gottes ist, so ist auch sein Leib Teil dieses Gedankens. Eine Theologie, die dem Menschen die schwierige Aufgabe vorenthalten möchte, diesen Gedanken und Heilsplan Gottes zu erkennen, indem der eigene Leib und die eigene Geschlechtlichkeit geordnet eingesetzt wird, sei dies im Zölibat oder innerhalb einer liebenden Beziehung, kann kurzzeitig anziehend wirken, setzt sich aber langfristig nur schwer zu überwinden Einwänden aus.
Die Lektüre der Genesis nimmt uns auch die Angst vor allen Schreckensbildern, die uns heute bezüglich der Entwicklungen der Technologie beherrschen. Wenn ein kleines Hirtenvolk, das umgeben war von grossen Kulturmächten, welche die Sonne und den Mond sowie andere Naturgewalten angebetet haben, uns gleich zu Beginn seiner Erzählung klarmacht, dass Gott alles zugunsten des Menschen
geschaffen hat und dieser von Gott geschaffene Mensch darüber herrschen soll, dann erkennen wir den Kleinmut und den Rückfall in heidnisches Gedankengut, das uns heute dominiert, wenn die Angst vorherrscht, künstlich geschaffene Intelligenz werde uns bald den Rang als Krone der Schöpfung ablaufen. Bisher gibt es kein Anzeichen, dass es neben dem menschlichen Geist etwas Anderes gibt, was sich selbst Ziele setzen könnte. Das ist die Würde der Gottesebenbildlichkeit, von der das erste Buch Mose spricht. Genauso wie Gott aus freiem, für uns unerklärlichem Antrieb den Menschen erschuf, sind wir in der Lage uns Ziele zu setzen, die auch die Maschinen sich nie erklären werden können. Der Unterschied zwischen unserer Situation gegenüber Gott und derjenigen der Maschinen gegenüber uns ist aber, dass wir durch die Liebe, die wir für den Mitmenschen spüren, zumindest einen Teil des Geheimnisses Gottes Antriebs erahnen können, währenddem die Maschinen hier ahnungslos verbleiben. Anstatt Angst zu haben, dass demnächst eine Revolution der Technik den Aufstieg der Computer auf die Höhe des Menschen bewirken kann, sollten wir uns lieber davor fürchten, dass es nicht eher unser Verlust an Empathie, Nächstenliebe und des Verantwortungsbewusstseins ist, welcher diese Gleichsetzung von Maschine und Mensch zur immer realistischer werdenden Dystopie werden lässt. Gerade die Betonung der individuellen Verantwortung jedes Menschen wäre in einer Zeit, in welcher die Schwächsten der Gesellschaft Entscheiden gegenüberstehen, bei denen eine Zwangsläufigkeit oder höhere Sachlichkeit postuliert wird, die aber in Wahrheit individuellen und auf eigenen Nutzen ausgerichteten Zielen unterworfen sind, mehr als wichtig. Zudem würde es aber auch innerhalb der Kirche zu einer Entpolarisierung führen, die heute in vielen Fragen rund um Ehe, Geschlechtlichkeit und Familie sichtbar ist. Denn auch jeder Verfechter des klassischen Eheverständnis und einer auf Liebe und Weitergabe des Lebens ausgerichteten Sexualität muss den Unmut verstehen, den Menschen haben, welche in Beziehungen leben, die diesem Ideal nicht entsprechen und dadurch Zielschreibe der Kritik werden, dafür aber klare Stellungsnahmen der Kirche bei anderen die Individualmoral betreffenden Fragen vermissen. Wenn beispielsweise jede Kritik an einer zu stark auf den Profit ausgerichteten Unternehmenspolitik sofort mit dem Generalverdacht abgekanzelt wird, sie stünde der Befreiungstheologie nahe, oder jede
Aufforderung zu einem grösseren Umweltbewusstsein als Abdriften in ökologische Schwärmerei verurteilt wird, ist es schwierig den Anspruch der Kirche aufrechtzuerhalten, in Fragen der Ehe und des Geschlechtslebens den göttlichen Willen zu verkünden. Auch wenn aus theologischer Sicht die Antworten, welche die Kirche beim Lebensschutz, Ehe und Familie geben kann klarer und eindeutiger sind als bei sozialpolitischen und ökologischen Themen, lässt sich die Verantwortung, die aus christlicher Sicht dem Menschen zukommt, nicht nur auf einzelne Gebiete beschränken. Eine grössere Sensibilisierung diesbezüglich würde das Bewusstsein schärfen, dass niemand von uns der Grösse dieser Aufgabe moralisch gewachsen ist. Vielleicht ist dies sogar die zentrale Erkenntnis jeder christlichen Anthropologie: Die Grösse der Aufgabe, die dem Menschen durch seine Verantwortung für sein Leben, dasjenige seiner Mitmenschen und die ihm unterworfene Natur gegeben ist, übersteigt unweigerlich seine Fähigkeiten. Der Ausweg ist nicht darin zu suchen, diese Verantwortlichkeit zu delegieren und abzuschütteln oder die Verantwortung nur dort zu suchen und bei Anderen anzuprangern, wo man ihr selbst – vermeintlich
– gerecht werden kann, sondern sich ständig vor Augen zu führen, dass wir alle Sünder sind, die der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Wie weit dieses Bewusstsein in verschiedenen, sich teilweise heftig bekämpfenden Lagern der westlichen Christenheit verloren gegangen ist, zeigte damals die Begeisterung sowie die Empörung, welche die Aussage von Papst Franziskus nach sich zog, als er auf die Frage eines Journalisten erwiderte, dass es nicht an ihm sei, Homosexuelle zu verurteilen. Währenddem sogenannt progressive Kreise diese Aussage als Befürwortung einer sexuellen Libertinage bejubelten, erkannten sogenannt konservative Katholiken darin Anzeichen einer Häresie. Nur Wenige erkannten darin den Aufruf des Oberhauptes der Katholischen Kirche, in dessen Pontifikat keine Änderung des Katechismus in Fragen der Homosexualität vorgenommen wurde, andere Menschen nicht zu verurteilen, um damit ein im Evangelium zentrales Gebot zu erfüllen.
Die Erschaffung des Menschen aus dem Boden, die von Gott bewusste Begrenzung seiner Lebenszeit und die Verheissung, dass wir nach unserem irdischen Leben in die zeitlose Ewigkeit und Gemeinschaft mit ihm eintreten, sind allesamt aus dem alten Testament und dem Evangelium entnommene
Glaubensinhalte des Christentums, die nicht in Einklang zu bringen sind mit der Vorstellung, dass die Technologie uns ewiges Leben ermöglichen kann und soll. Da es – Gott sei Dank – wenig Anzeichen gibt, dass dies in der näheren oder fernen Zukunft möglich sein wird, ist es in der Gegenwart für die Kirche zentral, den Menschen gegenüber die Wichtigkeit der beiden Zeitpunkte in der menschlichen Existenz zu betonen, die als einzige einen Einfluss auf die Qualität und die Würde des Lebens haben. Jeden Tag rufen sich Katholikinnen und Katholiken rund um den Globus diese beiden Zeitpunkte in Erinnerung, wenn sie das Ave Maria beten. Wirklich entscheidend für den Christen ist das „Jetzt“ und
„Hier“ und der Zeitpunkt des Eingangs in die Ewigkeit.