
Alles zum Thema Heiliger Joseph
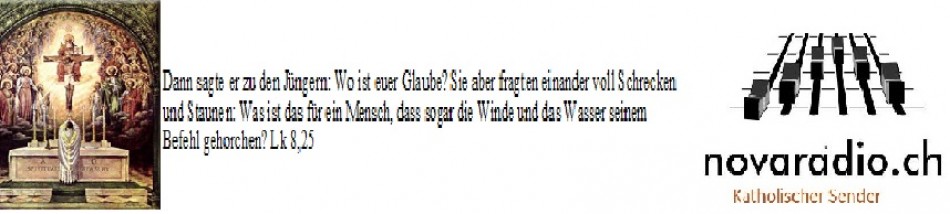

Alles zum Thema Heiliger Joseph
Am 17. März feiern Iren auf der ganzen Welt den Saint Patrick’s Day. Der Heilige, der im 5. Jahrhundert lebte und wirkte, ist Anlass für Paraden, Festlichkeiten – und grüne Flüsse. Einmal im Jahr färbt sich in New York der Hudson River grün, in Dublin malen sich die Menschen dreiblättrige Kleeblätter auf ihre Gesichter. In vielen Ländern gibt es bunte Paraden und Festumzüge. Es ist kein Karneval, sondern St. Patrick’s Day. Am 17. März feiert man den populären Nationalheiligen Irlands.
Entstehung des St. Patrick’s Day: Der Heilige Patrick, dessen Todestag am 17. März gefeiert wird, war Bischof und ist Schutzpatron der Iren. Wie bei den frühen Heiligen üblich, gibt es auch über Patricks Leben kaum gesicherte Fakten. Der Legende nach kam er als Sklave nach Irland, wurde später in Frankreich zum Priester ausgebildet und missionierte dann als Bischof die Insel. Patrick soll nicht nur die Schlangen, also den heidnischen Glauben, aus dem Land vertrieben, sondern auch Klöster und Schulen gegründet haben. So leistete er einen beträchtlichen Beitrag zur Bildung der Bevölkerung.

Bräuche zum St. Patrick’s Day: Der Feiertag wird nicht nur auf der grünen Insel begangen. Iren in der ganzen Welt – besonders in Einwanderungsländern wie Australien oder den USA – feiern am 17. März ihren Schutzpatron. In Großbritannien, Nordirland sowie der kanadischen Provinz Neufundland ist der Tag sogar, wie in Irland selbst, ein gesetzlicher Feiertag. Am St. Patrick’s Day werden große Prozessionen und Umzüge veranstaltet und die Menschen finden sich zu Gottesdiensten zusammen. Typisch für die Feierlichkeiten sind auch die Céilís: Irische Volkstänze, die von irischer Musik begleitet werden. Seit 1997 gibt es außerdem das „St. Patrick’s Festival“, eine mehrtägige Festlichkeit zu Ehren des Heiligen. Den Besuchern werden Livemusik, Theater, Feuerwerk und Paraden geboten. Gut nur, dass die Kirche am 17. März, der eigentlich in die Fastenzeit fällt, die Fastengebote für einen Tag aufhebt. Ein weiterer Brauch bezieht sich auf die grüne Farbe – Symbol der Insel. Die Menschen kleiden sich in Grün oder heften sich zumindest ein grünes Kleeblatt an. Das geht sogar so weit, dass das Bier an diesem Tag grün eingefärbt wird und auch Flüsse einen grünen Anstrich erhalten, wie etwa der Chicago River.
Wissenswertes zu St. Patrick’s Day: Das Kleeblatt als Symbol der Iren geht auf den Heiligen St. Patrick zurück: Anhand der drei Blätter der Pflanze soll er den Iren die Dreifaltigkeit erklärt haben. Wenn der 17. März in die Osterwoche fällt, kann er auch ganz pragmatisch verschoben werden – wie es in den Jahren 1940 und 2008 der Fall war.
Missionarischer Erfolg
Höchstwahrscheinlich wurde Patrick im römischen Britannien geboren. Sein Vater war Beamter der römischen Besatzungsmacht und außerdem Diakon der römischen Kirche, sein Großvater war Priester. Mehr erfährt man aus seinen selbst verfassten Schriften: Demnach wurde er im Alter von 16 Jahren von Piraten aus seinem Heimatort entführt und als Sklave nach Irland gebracht. Mit 22 Jahren wurde er – nach erfolgreicher Flucht in seine alte Heimat – selbst zum Priester geweiht und studierte zunächst als Mönch in Gallien Theologie. Doch die „Stimme der Iren“ rief ihn im Traum in das Land seiner Gefangenschaft zurück. Trotz Bedenken seiner kirchlichen Oberen wurde er zum irischen Missionsauftrag berufen. Verbürgt ist sein Eintreffen im Jahr 432 in Irland zusammen mit 24 Gefährten, wo er ungefähr 30 Jahre lang so erfolgreich als Missionar im Norden der Insel wirkte, dass diese fortan als christliches Land erscheint.
Glaubhaft ist die Überlieferung, dass sich Patrick vor allem mit widerspenstigen keltischen Druiden auseinanderzusetzen hatte und auf viele Widerstände gegen seine Glaubenspredigten stieß. Allen Widerständen zum Trotz gewann er jedoch viele Menschen für das Christentum und ließ zahlreiche Kirchen bauen.
Da Patrick während seiner Gefangenschaft die irisch-keltische Sprache gelernt hatte, konnte er in Liturgie und Lehre auf die Landessprache zurückgreifen, ein wichtiger Grund für die tiefe Verwurzelung des Glaubens in Irland. Zahlreiche irische Mönche zogen aufs Festland nach Gallien, Germanien und Italien. Sie nahmen sich die zunächst unfreiwillige Heimatlosigkeit des heiligen Patrick zum Vorbild und wurden Prediger des Evangeliums und Gründer klösterlicher Niederlassungen.
Viele Legenden ranken sich um die Person Patricks, die folkloristisch säkularisiert oder aber auch in religiösen Brauchtumsformen bis heute weiterleben. Dublin feiert Sankt Patrick mit einer großen Parade und vier feierlichen Tagen. Dabei werden Kunstschlangen, die ihre roten Zungen bedrohlich aus Papier- und Plastikleibern recken, durch die Stadt getragen, ein Verweis auf die Legende, Patrick habe von der Grünen Insel die letzten Schlangen vertrieben.

Der Berg, das Grab und das Kleeblatt
Bis heute ist der Croagh Patrick genannte Berg in der Grafschaft Mayo, wohin sich der Heilige zum vorösterlichen Fasten zurückgezogen haben soll, die wichtigste Pilgerstätte in Irland (siehe Bild ganz oben). Scharen von Pilgern ziehen auf den westirischen Berg, viele gehen mit bloßen Füßen oder rutschen auf den Knien, um Buße zu tun. Seinen Gläubigen veranschaulichte Patrick die Dreifaltigkeit anhand eines dreiblättrigen Kleeblattes. Es wurde zum irischen Nationalsymbol, dem Shamrock.
In Downpatrick (Nordirland) zeigt man Patricks angebliches Grab mit einem großen, neuzeitlichen Granitbrocken. Westlich von Downpatrick soll Patrick auf einem Hügel seine Hauptkirche gebaut haben, genau dort, wo heute die Kathedrale der anglikanischen Church of Ireland steht – in Sichtweite der katholischen Kathedrale. In den Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten versuchen beide Seiten bis heute, Patrick für ihre Sicht der Dinge zu vereinnahmen.
Patron von Irland, der Bergleute, Schmiede, Friseure und Böttcher; des Viehs; gegen Ungeziefer, Viehkrankheiten, Anfeindungen des Bösen; für die armen Seelen.
Schutzschild des Heiligen Patrick
Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft die Anrufung der Dreifaltigkeit,
durch den Glauben an die Dreiheit, durch das Bekennen der Einheit,
ich mache mich auf den Weg, dem Schöpfer zu begegnen.
Ich erhebe mich heute durch Gottes Kraft, sie lenke mich.
Gottes Macht halte mich,
Gottes Weisheit führe mich,
Gottes Auge schaue auf mich,
Gottes Ohr höre für mich,
Gottes Wort spreche für mich,
Gottes Hand schütze mich,
Gottes Weg liege vor mir,
Gottes Schild schirme mich.
Gottes Heerschar rette mich vor den Schlingen des Teufels,
vor den Versuchungen des Bösen,
vor den Verlockungen des Fleisches,
vor jedermann, der mir übel will,
fern und nah, allein und in der Masse.
Ich erhebe mich heute kraft der Geburt Christi und seiner Taufe,
kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung,
kraft seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt,
kraft seiner Wiederkunft zum letzten Gericht.
Ich erhebe mich heute kraft der Liebe der Cherubim
Im Gehorsam der Engel,
im Dienen der Erzengel,
in der Hoffnung auf die Auferstehung und ihre Gaben,
in den Gebeten der Patriarchen
in den Weissagungen der Propheten,
in der Verkündigung der Apostel,
in dem Glauben der Bekenner,
in der Unschuld der heiligen Jungfrauen,
in den Werken der Gerechten.
Christus mit mir,
Christus vor mir,
Christus hinter mir,
Christus in mir,
Christus unter mir,
Christus über mir,
Christus mir zur Rechten,
Christus mir zur Linken,
Christus, wo ich liege,
Christus, wo ich sitze,
Christus, wo ich mich erhebe.
Christus im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt,
Christus im Munde eines jeden, der zu mir spricht,
Christus in jedem Auge, das mich sieht,
Christus in jedem Ohre, das mich hört.
Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft,
die Anrufung der Dreifaltigkeit,
durch den Glauben an die Dreiheit,
durch das Bekennen der Einheit,
ich mache mich auf den Weg, dem Schöpfer zu begegnen.

Mitarbeiter des Apostel Paulus, erster Bischof von Ephesus, Märtyrer
* in Lystra, heute das Dorf Kilistra (Gökyurt) bei Konya in der Türkei
† 97 in Ephesus, heute Ruinen bei Selçuk in der Türkei
Timotheus wurde als Sohn eines heidnischen Vaters und einer jüdischen Mutter namens Eunice geboren. Der Tatsache, dass die Mutter eine Mischehe eingegangen war und dass sie ihren Sohn nicht hatte beschneiden lassen, lässt vermuten, dass Timotheus in einer nicht sehr gläubigen Familie aufgewachsen ist, auch wenn gesagt wird, dass er die Schriften von Kindheit an kannte (2. Timotheusbrief 3,15). Als Paulus zu Beginn der zweiten Missionsreise durch Lystra – das heutige Dorf Kilistra (Gökyurt) bei Konya – kam, wählte er Timotheus zum Gefährten, da er ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium
hatte; er wurde dann von Paulus beschnitten, um einen Konflikt mit Juden zu vermeiden (Apostelgeschichte 16, 2 – 3).
Als Mitarbeiter von Paulus wurde Timotheus mit wichtigen Missionen beauftragt. So wirkte er in den griechischen Städten Beröa – dem heutigen Veria – (Apostelgeschichte 17, 14), wo die Bema gezeigt wird, von der Paulus (angeblich) predigte. Timotheus missionierte auch in Athen 1 und Thessaloniki (1. Thessalonicherbrief 3, 1 – 6), in Korinth (1. Korintherbrief 4, 17) sowie später in Ephesus – heute Ruinen bei Selçuk – (1. Korintherbrief 16, 8. 10) und in den römischen Provinzen von Makedonien (Apostelgeschichte 19, 22). Timotheus begleitete Paulus auf seiner Rückreise nach Jerusalem (Apostelgeschichte 20, 4), war jedoch offensichtlich anderswo tätig, als dieser nach Rom aufbrach.
Timotheus war von Paulus hoch geschätzt. Ich habe keinen Gleichgesinnten, der in so echter Weise für eure Angelegenheiten Sorge tragen wird
, schreibt er den Philippern (2, 20); als mein geliebtes und treues Kind im Herrn
bezeichnet er ihn im 1. Brief an die Korinther (4, 17); als Mitabsender wird er im 1. Brief an die Thessalonicher, im 2. Brief an die Korinther, im Brief an die Philipper und im Philemonbrief genannt.
Während Paulus‘ erster Gefangenschaft in Rom besuchte ihn Timotheus und wurde vermutlich mit einer Botschaft nach Philippi – den heutigen Ruinen bei Krinides in Griechenland – geschickt (Philipperbrief 2, 19); dort kann man die Reste der ihrer Form wegen Oktagon genannten, auf der ältesten Kirche der Stadt erbauten Bischofskirche sehen.
Der traditionellen Auslegung des 1. und 2. Briefes an Timotheus zufolge zog Paulus nach seiner Freilassung in den Osten zu Timotheus und übertrug ihm die Aufsicht in Ephesus, eine Stellung, die große Verantwortlichkeit erforderte. Aus Sorge schickte er ihm demnach einen Brief, der Ratschläge und Warnungen enthielt und als 1. Brief an Timotheus bekannt ist, und während seiner zweiten Gefangenschaft schrieb er den 2. Brief an Timotheus, der einen Aufruf an seinen geliebten Schüler enthält, ihn so schnell wie möglich zu besuchen.
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde nach den Angaben des Hebräerbriefes (13, 23) auch Timotheus verhaftet, jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen. Gut bezeugt – im 1. Timotheusbrief (1, 3) und durch Eusebius von Cäsarea – ist der weitere Aufenthalt von Timotheus in Ephesus; die Überlieferung nennt ihn Bischof von Ephesus und berichtet von seinem Märtyrertod, nachdem er sich einem ausschweifenden heidnischen Fest widersetzt hatte; unter => Nero schwer gemartert, wurde er von Engeln getröstet, sah den Himmel offen und die Märtyrerkrone, die Christus ihm bereithielt.
Timotheus‘ Leichnam wurde von Ephesus in die Apostelkirche nach Konstantinopel – dem heutigen Ístanbul – überführt und nahe der Gebeine von Lukas und Andreas bestattet, wie Hieronymus 356 in seiner Chronik berichtete. Von dort kamen sie 1204 in die Kathedrale nach bei Campobasso, wo sie am 11. Mai 1945 bei Bauarbeiten wieder entdeckt wurden.
1 ▲ Die erste Kirche in Athen gab es der Überlieferung zufolge schon im 1. Jahrhundert, sie habe eine von Lukas selbst gefertigte Marienikone besessen. 1859 entdeckte der Archäologe Kyriakos Pittakis an der Stelle der heutigen Lukas-Kirche im Stadtteil Agios Loukas von Athen, 5 km nördlich der Akropolis die Mauern dieser Kirche an dem Platz einer kleinen Lukas-Kirche, die dann der heutigen gewichen ist.
2 ▲ Paulus‘ wird als Verfasser der beiden Timothesbriefes weithin bestritten.
 Attribute: Keule, Steine
Attribute: Keule, Steine Patron gegen Bauchschmerzen und Magenleiden
Patron gegen Bauchschmerzen und Magenleiden![]() Bauernregel:
Bauernregel: Timotheis, / der bricht das Eis; / hat er keins, / dann macht er eins.
Bischof von Rom
Silvester war traditioneller, aber zweifelhafter Überlieferung zufolge der Sohn von Justa. Er wurde wohl noch vor Beginn der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian im Jahr 284 zum Priester geweiht. Vor den Verfolgungen – und der in Rom grassierenden Lepra – zog er sich dann zeitweise in eine Höhle am Mons Soracte – heute Monte Soratte – zurück; auf dessen Gipfel habe er eine Kirche errichtet an der Stelle eines zuvor dort für die Dis Pater, die Götter der Unterwelt Pluto und Orcus, stehenden heidnischen Heiligtums; daraus wuchs ein ihm geweihtes Kloster.

Sein Amt als römischer Bischof trat Silvester 314 an – ein Jahr, nachdem die römischen Kaiser Konstantin der Große und Licinius 313 die christliche Kirche anerkannt und im Edikt von Mailand jedem Bürger des Reiches das Recht auf freie Religionsausübung gewährt hatten. Diese Ereignisse, oft legendär überhöht, begründen Silvesters Bedeutsamkeit, sein eigenes Wirken hat dazu wenig beigetragen.
Die meist im 5. Jahrhundert entstandenen Legenden berichten Silvesters Standhaftigkeit während der noch andauernden Verfolgungen: Er warnte den Statthalter, der ihn zwingen wollte, die von ihm verwahrten Besitztümer von Christen herauszugeben, bis dieser beim Essen an einer Fischgräte erstickte. Er heilte und bekehrte den angeblich aussätzigen Kaiser; die Legende sagt auch, dass er Konstantin getauft habe, was geschichtlich nicht haltbar ist. Diese Legende ging auch in die Konstantinische Schenkung ein, eine gefälschte Urkunde, die zur Legitimation der Besitzansprüche und Herrschaftsrechte des Papsttums diente, derzufolge Konstantin dem Bischof die Stadt Rom und das ganze Abendland zu eigen gab und ihm das Tragen der kaiserlichen Insignien erlaubte.
Die Legenden erzählen von einem Streitgespräch, das Silvester mit zwölf jüdischen Rabbinern geführt habe, weil Helena ihren inzwischen getauften Sohn Konstantin zum Judentum bekehren wollte. Silvester obsiegte im Disput gegen elf der gelehrten Juden; der zwölfte, Zambri, tötete einen Stier durch die Nennung des Namens Gottes, den der Stier nicht ertragen konnte, um so die Kraft seines Glaubens zu beweisen. Silvester aber konnte mit Gottes Hilfe sogar den toten Stier zum Leben auferwecken, worauf auch Zambri wie die anderen Rabbiner und Helena sich sofort taufen ließen. Heidnische Priester bekehrte Silvester demnach, indem er einen Drachen bezwang.
Weder bei der epochalen Hinwendung Konstantins zum Christentum noch bei der Bewältigung der kirchenpolitischen und dogmatischen Auseinandersetzungen spielte Silvester eine für seine Zeitgenossen erinnerungswürdige Rolle. Er nahm weder 314 an der Reichssynode in Arles teil, wo die Auseinandersetzung mit dem Donatismus begann, noch 325 am 1. Konzil von Nicäa mit den wegweisenden Entscheidungen um die Wesensart Jesu Christi und gegen den bedrohlichen Arianismus. Den Synodalen von Arles schrieb er, er könne die Apostelgräber in Rom nicht im Stich lassen. Noch im späten 4. Jahrhundert belasteten die Donatisten Silvester selbst wie seine Vorgänger mit dem Vorwurf des vorübergehenden Abfalls vom Glauben während der Verfolgungen unter Kaiser Diokletian. Das Fernbleiben vom Konzil in Nicäa begründete Eusebius von Cäsarea mit Silvesters hohem Alter, aber er hat das Konzil immerhin noch um ein Jahrzehnt überlebt.
Silvester ließ über den Priscilla-Katakomben eine Kirche bauen. An der Stelle der heutigen Kirche San Martino ai Monti ließ er in einem geschenktem Haus – wohl ein Nebengebäude der riesigen Thermen des Trajan – ein Oratorium errichten, das allen Märtyrern geweiht wurde; in ihm fand 324 eine Sitzung zur Vorbereitung des 1. Konzils von Nicäa statt. Silvester wurde dann im Coemeterium der Priscilla bestattet, ob in der von ihm erbauten Kirche oder einem der unterirdischen Gänge ist umstritten. Um 760 erfolgte durch Papst Paul I. die Übertragung seiner Gebeine in die Kirche San Silvestro e Stefano – die heutige Kirche San Silvestro in Capite in Rom, auch in seiner Kirche San Martino ai Monti liegen Reliquien in der Krypta. Weitere Gebeine – darunter ein Teil der Schädelrelliquie – kamen in das dann ihm geweihte Kloster San Silvestro der Benediktiner nach Nonàntola.
Die älteste Fassung des Actus Silvestri stammt wohl aus dem im letzten Jahrzehnt des 4. bis ersten Jahrzehnt des 5. Jahrhundert, angeregt durch das damalige römisch-kirchliche Selbst- und Geschichtsbewusstsein. Das Fest für Silvester wird schon seit dem 5. Jahrhundert im ganzen christlichen Europa gefeiert. Die Silvesternacht zum Jahreswechsel ist von einer Fülle des Brauchtums geprägt, Silvesterumzüge waren früher verbreitet.
Patron der Haustiere; für eine gute Futterernte, ein gutes neues Jahr
Bauernregeln: Silvesternacht düster oder klar, / deutet auf ein neues Jahr.
Ist’s zu Silvester hell und klar, / steht vor der Tür das neue Jahr.
Gefriert’s an Silvester zu Berg und Tal, / geschieht auch dies zum letzten Mal.
Wind in St. Silvesters Nacht, / hat nie Wein und Korn gebracht.
Silvester Wind und warme Sunnen / wirft jede Hoffnung in den Brunnen.
Silvesternacht wenig Wind und Morgensonn, / gibt Hoffnung auf Wein und Korn.
Quelle: Heiligenlexikon