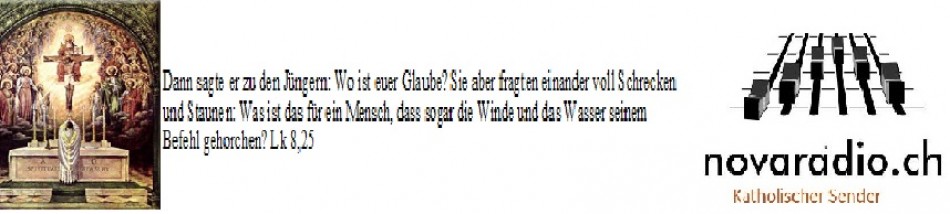Einkehrtag
An der Schwelle zur Passionszeit ergeht eine herzliche Einladung, zum Einkehrtag nach Zürich zu kommen. Während die Erwachsenen den Vorträgen lauschen, dürfen die Kinder schöne Heimosterkerzen gestalten.
Sonntag, 17. März 2024, Pfarrsaal der Pfarrei Herz-Jesu, Schwamendingenstrasse 55, Zürich-Oerlikon. 14.30 Uhr Vortrag von P. Ramm: „SACERDOS ET HOSTIA – Das Priestertum Jesu“ Die Vorträge sollen zu einem tieferen Verständnis dessen führen, was der Heiland in seiner Passion für uns getan hat und was er uns im heiligen Messopfer schenkt. Abschluss mit einer feierlichen hl. Messe um 17.00 Uhr.
Für die Kinderbetreuung ist Voranmeldung nötig (mit Namen und Alter): p.ramm@fssp.ch
Pfingstwallfahrt von Paris nach Chartres
Zu Pfingsten werden es wieder viele Tausende sein, die in glaubensfroher Gemeinschaft den Pilgerweg von Paris nach Chartres unter die Füße nehmen. Möchten Sie nicht dabei sein? Es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest ein wenig auf der Website zu stöbern: https://www.parischartres.info/
Venite! – Videte!
Eigentlich ist es kaum zu glauben, dass ein Haus wie St. Pelagiberg Schwierigkeiten hat, genügend Pensionäre zu finden. Ich selbst hätte keinen Zweifel, dass es gut ist, hier und sonst nirgends die Tage des Alters zu verbringen. Wer immer sich für das ‚Kurhaus Marienburg‘ interessiert, wird kompetent und detailliert beraten. Gerne weise ich auf das Angebot hin, vom 4. – 13. März 2024 einen Gratisaufenthalt zu ‚buchen‘, um ganz unverbindlich hineinzuschnuppern und das Haus kennenzulernen. (Kontakt: 0041 71-433 11 66 / info@kurhaus-marienburg.ch)
Heiliges Land
Es ist absehbar, dass wir vom 21. April bis zum 5. Mai eine ganz besonders schöne Heilig-Land-Wallfahrt haben werden. Voraussichtlich wird nicht viel los sein. Zugleich wird sich das Land in seiner allerschönsten Frühlingspracht zeigen. Israel ist nicht gefährlicher als Hamburg, München oder Zürich. Gerne sende ich detaillierte Informationen. – Man müsste sich aber rasch entscheiden …
Exerzitien für Jugendliche und junge Erwachsene
Eine Frühjahrskur für die Seele? Es ist erhebend, in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sich dem wirklich Wesentlichen zuzuwenden. Das tut gut!!! – Möchtest Du nicht in der Osterwoche nach Marienfried kommen?
Ich würde mich freuen, im ein oder anderen Punkt Ihr Interesse geweckt zu haben, und wünsche frohes Fasten!
P. Martin Ramm FSSP