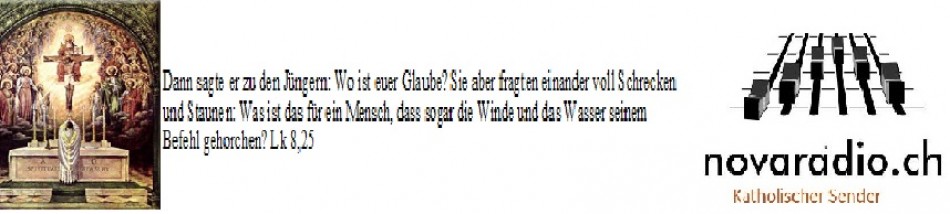Kriminelle Banden, Armut und fehlende Berufungen – das Leben der Christen in Honduras ist nicht einfach. Dies hat Veronica Katz, Projektleiterin des internationalen Hilfswerks «Kirche in Not (ACN)» für die mittelamerikanischen Länder, auf ihrer Reise durch das Land hautnah erfahren. Die pastoralen Früchte und das Engagement der Katholiken in diesem Land sind jedoch eine Quelle der Hoffnung.

Können Sie die Situation beschreiben, die Sie auf Ihrer Reise nach Honduras erlebt haben?
Honduras, das zweitärmste Land Lateinamerikas, leidet unter extremer Armut, die 75 % der Bevölkerung betrifft, sowie unter erheblicher Ungleichheit. Eine schwere Energiekrise mit ständigen Stromausfällen zur Rationierung der Energieversorgung belastet das Land zusätzlich. Extreme Klimabedingungen führen zu Dürreperioden und sintflutartigen Regenfällen, die alles überfluten und die Landwirtschaft beeinträchtigen. Doch eine noch grössere Bedrohung stellt die Gewalt der „Maras“ dar.
Was sind diese „Maras“?
Es handelt sich um typische mittelamerikanische Banden, die eng mit dem Drogenhandel verbunden sind und äusserst gewalttätig agieren. Honduras dient als Transitland für den Drogenhandel in die USA und andere Länder. Die Maras kontrollieren in Honduras praktisch alles. Familien können wegen der „Kriegssteuer“, welche die Maras den Bürgern auferlegen und die sie oft nicht bezahlen können, keine Geschäfte führen.

Wie erlebt die honduranische Kirche dieses Klima der Gewalt?
Während unseres Besuchs in der Hauptstadt erfuhren wir, dass es in einigen Gegenden sehr schwierig ist, pastorale Arbeit zu leisten, insbesondere aufgrund der Konflikte zwischen rivalisierenden Banden, die um die Kontrolle des Territoriums kämpfen. In einer bestimmten Gemeinde, die wir besuchten, wird das Gebiet von zwei solcher Banden kontrolliert, was die kirchliche Arbeit stark beeinträchtigt. Die Bischofskonferenz hat bereits zum Frieden aufgerufen und die Regierung aufgefordert, angesichts der Unsicherheit im Land Massnahmen zu ergreifen. Die pastorale Arbeit der katholischen Kirche ist jetzt sehr wichtig.
Welchen weiteren Herausforderungen muss sich die Kirche in ihrer pastoralen Arbeit stellen?
Der Priestermangel ist ein ernsthaftes Problem. In Honduras betreut ein Priester viermal so viele Menschen wie beispielsweise in Frankreich. Hinzu kommen das niedrige Bildungsniveau, der Mangel an Transportmitteln in ländlichen Gebieten und unzureichende Ausbildungsprogramme in den Pfarreien. Die Gläubigen sind arm und der Mangel an katechetischem Material ist enorm. Sie wünschen sich Ausbildungsmaterial, haben aber nicht die Mittel, es zu erwerben.

Andererseits ist die Regierung bei der Erteilung von Visa an ausländische Geistliche sehr streng. Es werden viele Anforderungen an sie gestellt und sie müssen viele Dokumente vorlegen, was ihnen die Einreise und das Wirken im Land erschwert.
Was möchten Sie von dieser Reise besonders hervorheben?
Etwas hat mich sehr beeindruckt: Ein Priester berichtete uns, dass in seiner Pfarrei zu Beginn seiner Amtszeit ein schwerwiegender Konflikt zwischen zwei Gruppen herrschte. Doch durch treues Gebet hat Gott gehandelt und die Gruppen sind nun versöhnt. Es ist kaum vorstellbar: Gemeinden, die sich früher gegenseitig umbrachten, beten nun gemeinsam.
Die Honduraner zeigen eine bemerkenswerte Offenheit gegenüber dem Göttlichen – das ist gut, weil sie Gott von Herzen suchen, aber es macht sie auch empfänglich für jeden, der ihnen eine Spiritualität vermitteln will. Das bedeutet auch, dass sie leicht von Sekten, die sich im Land ausgebreitet haben, vereinnahmt werden können oder Antworten in abergläubischen Praktiken suchen, die in Honduras präsent sind.

Was ist der Grund für die Zunahme von Sekten in Honduras?
Die Honduraner sind sehr gläubige Menschen. Sie brauchen Gott. Doch wie bereits erwähnt, gibt es nur wenige katholische Priester, die den Menschen in ihren geistlichen Nöten helfen können. Die wenigen, die es gibt, haben eine enorme Arbeitsbelastung. Honduras ist das Land mit dem höchsten Anteil an Protestanten in ganz Lateinamerika. Evangelikale Kirchen haben deutlich zugenommen, und die Zahl der Protestanten ist inzwischen höher als die der Katholiken. Darüber hinaus werden viele dieser protestantischen Sekten von Gruppen in den Vereinigten Staaten finanziert: Sie vervielfachen die Präsenz von Pastoren, um dort zu wirken, wo die katholischen Priester nicht hinkommen oder nicht so aktiv sind. Ein Katholik, der nur aus Tradition und nicht aus Überzeugung katholisch ist, schliesst sich so schnell diesen Glaubensgemeinschaften an. Die katholische Kirche unternimmt grosse Anstrengungen, um ihren Gläubigen angesichts des riesigen Angebots und der Präsenz durch andere christliche Konfessionen und Sekten eine solide Bildung zu vermitteln.
Und wie engagiert sind die Gläubigen, trotz aller Schwierigkeiten?
Die meisten Katholiken engagieren sich stark in ihren Pfarreien und nehmen aktiv an sozialen Aktivitäten teil. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Menschen, die tagsüber unermüdlich auf den Kaffee- oder Maisfeldern arbeiten oder sich um Tiere kümmern, ihre Nachmittage in den Pfarreien verbringen. Sie füllen ihren Terminkalender mit religiösen Aktivitäten, die ihren ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Wir haben Gemeinschaften gesehen, die voller Leben und sehr gut organisiert sind. Sie praktizieren ihren Glauben nicht allein, sondern leben ihn als Gemeinschaft, was sehr ermutigend ist. Durch das Engagement motivierter Priester und Laien sowie eine strukturierte Seelsorge können positive Ergebnisse und pastorale Früchte erzielt werden.

Sie haben viele Projekte von «Kirche in Not (ACN)» in Honduras besucht. Welche Projekte unterstützt das Hilfswerk vor Ort?
In den letzten fünf Jahren hat «Kirche in Not (ACN)» 65 Projekte in Honduras durchgeführt, für die fast CHF 1 Mio. ausgegeben wurd. Fast ein Drittel davon für den Bau und die Sanierung von Pfarreien, ländlichen Kapellen und Gemeindesälen. Wir haben auch die Ausbildung von Laienseelsorgern und Seminaristen, den Lebensunterhalt von Ordensschwestern, katechetisches Material und Medien sowie die Bereitstellung von Fahrzeugen für die Missionstätigkeit unterstützt.
Quelle: Kirche in Not Schweiz