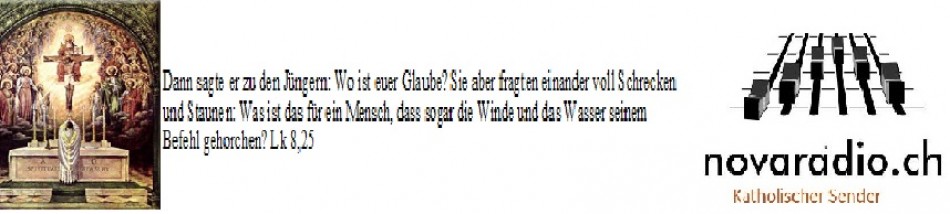Die Beiträge zweier hochrangiger Prälaten dürfen nicht ignoriert werden: die eine von Robert Kardinal Sarah, die sich am 9. April an die Bischöfe von Kamerun wandte; die andere von Walter Kardinal Brandmüller, der am 30. März per kath.net an seine deutschen Landsleute schrieb. Obwohl sie sich in ihrem Inhalt, ihrem Ton und ihrer Art unterscheiden, schlagen sie doch den gleichen Ton an: Beseelt von der wahren Liebe zur Braut Christi, appellieren diese Nachfolger der Apostel an ihre Herde, den Glauben in der Kirche wiederzuerlangen – jeder erfüllt seine besonderen Pflichten je nach seinem Stand – als Bischöfe, Priester oder Laien. Die eindringlichen Bitten der Kardinäle kommen zur Halbzeit der laufenden Synode über Synodalität.

Kardinal Sarah lobte zu Beginn seiner bewegenden Rede in Kamerun seine Mitbrüder im Bischofsamt für ihre „mutige und prophetische“ Antwort auf die Bittsteller der Fiducia, in der sie die Möglichkeit der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ablehnten, die durch das vatikanische Dokument autorisiert ist. „Wenn Sie an die katholische Lehre zu diesem Thema erinnern“, so der Kardinal, „haben Sie der Einheit der Kirche sehr und zutiefst gedient. Ihr habt ein Werk der pastoralen Nächstenliebe vollbracht, indem ihr euch an die Wahrheit erinnert habt.“

Insbesondere von den afrikanischen Bischöfen wird allgemein erwartet, dass sie, wenn nötig, in der bevorstehenden zweiten Sitzung der Synode über Synodalität im Oktober eine starke Haltung zur Sexualmoral einnehmen, und Kardinal Sarah betonte, dass es „wesentlich“ sei, dass sie dies „im Namen der Einheit des Glaubens und nicht im Namen bestimmter Kulturen“ tun.
Ihr unmissverständlicher Widerstand gegen die Fiducia Supplicans war von den vatikanischen Behörden als „Sonderfall“ Afrikas abgetan worden. Diese Ablehnung wiederholte die berüchtigten Äußerungen von Walter Kardinal Kasper, der, als er während der Familiensynode 2014 über die Opposition der afrikanischen Bischöfe gegen die homosexuelle Agenda sprach, zu Protokoll gab, dass sie „uns nicht zu viel sagen sollten, was wir zu tun haben“.
Kardinal Sarah verurteilte in scharfem Gegensatz dazu die Vorstellung, dass afrikanische Bischöfe die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aufgrund bestimmter kultureller Gegebenheiten, die für Afrika spezifisch sind, ablehnen, und forderte die Bischöfe auf, sich vor der nächsten Sitzung der Synode „mit großer Wachsamkeit“ vor diesem Punkt zu hüten. Der guineische Kardinal erklärte:
„Einige im Westen wollen uns glauben machen, dass Sie im Namen des afrikanischen kulturellen Partikularismus gehandelt haben. Es ist falsch und lächerlich, ihr solche Zwecke zuzuschreiben! Einige haben in einer Logik des intellektuellen Neokolonialismus behauptet, dass die Afrikaner aus kulturellen Gründen „noch“ nicht bereit seien, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Als ob der Westen den rückständigen Afrikanern voraus wäre. Nein! Sie haben für die ganze Kirche gesprochen »im Namen der Wahrheit des Evangeliums und für die Menschenwürde und das Heil der ganzen Menschheit in Jesus Christus«. Ihr habt gesprochen im Namen des einen Herrn, des einen Glaubens der Kirche. Wann sollte die Wahrheit des Glaubens, die Lehre des Evangeliums, jemals bestimmten Kulturen unterworfen werden? Diese Vision eines Glaubens, der den Kulturen angepasst ist, zeigt, wie sehr der Relativismus die Einheit der Kirche spaltet und korrumpiert.“
Kardinal Sarah verurteilte die „Diktatur des Relativismus“ und beschrieb sie als „Verletzung der Lehre und der Moral an bestimmten Orten unter dem Vorwand der kulturellen Anpassung“. Er sagte:
„Und sie werden Ihnen mit falscher Höflichkeit sagen: ‚Seien Sie versichert, dass wir Ihnen in Afrika diese Art von Innovation nicht aufzwingen werden. Du bist kulturell noch nicht bereit.“
„Aber wir, die Nachfolger der Apostel, sind nicht dazu bestimmt, unsere Kulturen zu fördern und zu verteidigen, sondern die universale Einheit des Glaubens! Wir, die Bischöfe von Kamerun, handeln nach Ihren Worten „im Namen der Wahrheit des Evangeliums und für die Menschenwürde und das Heil der ganzen Menschheit in Jesus Christus“. Diese Wahrheit ist überall dieselbe, in Europa ebenso wie in Afrika und den Vereinigten Staaten.“
Es waren natürlich die europäischen Missionare, die einst Afrika evangelisierten, und Kardinal Sarah, die den „geheimnisvollen Plan der Vorsehung“ erkannte, wies darauf hin, dass „es heute gerade die afrikanischen Episkopate sind, die die Universalität des Glaubens gegen die Verfechter einer zersplitterten Wahrheit verteidigen; die Verteidiger der Einheit des Glaubens gegen die Befürworter des Kulturrelativismus“ des Westens.
Er hielt es für nicht verwunderlich, dass »die Bischöfe Afrikas in ihrer Armut heute die Verkünder dieser göttlichen Wahrheit angesichts der Macht und des Reichtums gewisser Episkopate des Westens sind«, denn »was für die Welt töricht ist, hat Gott erwählt, um die Weisen zu verwirren; was für die Welt schwach ist, hat Gott erwählt, um die Starken zu verwirren; was in der Welt abscheulich und verachtet ist, was nichts ist, das hat Gott erwählt, um das zunichte zu machen, was ist.“ (1 Kor 1,28)
Als Kardinal Sarah über die Gründe für diese relativistische Zersplitterung der Wahrheit nachdachte, identifizierte sie „eine Art psychologische Angst“, die sich im Westen ausgebreitet hat: „die Angst, im Widerspruch zur Welt zu stehen“. Der Kardinal sprach insbesondere von den vielen westlichen Prälaten, die „von der Idee gelähmt sind, sich der Welt zu widersetzen“, die „davon träumen, von der Welt geliebt zu werden“ und in der Tat „den Willen verloren haben, ein Zeichen des Widerspruchs zu sein“, und stellte die Verbindung zum praktischen Atheismus her, der die Kirche heute befällt:
„Ich glaube, dass die Kirche unserer Zeit vom Atheismus versucht wird. Nicht intellektueller Atheismus, sondern dieser subtile und gefährliche Geisteszustand: fließender und praktischer Atheismus. Letzteres ist eine gefährliche Krankheit, auch wenn die ersten Symptome harmlos erscheinen. …
„Wir müssen uns dessen bewusst werden: Dieser fließende Atheismus fließt durch die Adern der zeitgenössischen Kultur. Sie wird nie beim Namen genannt, aber sie dringt überall ein, auch im kirchlichen Diskurs. Seine erste Wirkung ist eine Form der Schläfrigkeit des Glaubens. Es betäubt unsere Fähigkeit zu reagieren, Fehler und Gefahren zu erkennen. Sie hat sich in der ganzen Kirche ausgebreitet.“
Als weiteren Weg forderte Kardinal Sarah seine Mitbrüder im Bischofsamt auf, „anders zu denken“. Er plädierte:
„Wir dürfen uns nicht auf Lügen einlassen! Das Wesen des fließenden Atheismus ist das Versprechen eines Ausgleichs zwischen Wahrheit und Lüge. Es ist die größte Versuchung unserer Zeit! Wir alle sind schuldig der Anpassung, der Komplizenschaft mit dieser großen Lüge, die der fließende Atheismus ist! Wir geben vor, christliche Gläubige und Männer des Glaubens zu sein, wir zelebrieren religiöse Riten, aber in Wirklichkeit leben wir als Heiden und Ungläubige.“
Der Kardinal beendete seine große Berufung, einen anderen Weg in der Kirche zu finden, mit aller geistlichen Kraft, die ihm gegeben wurde:
„Als Pastor möchte ich Sie heute von ganzem Herzen einladen, diese Entscheidung zu treffen. Wir dürfen keine Parteien in der Kirche schaffen. Wir dürfen uns nicht zu den Rettern dieser oder jener Institution erklären. All dies würde zum Spiel des Gegners beitragen. Aber jeder von uns kann heute entscheiden: Die Lüge des Atheismus wird in mir keinen Platz mehr finden. Ich will nicht mehr auf das Licht des Glaubens verzichten, ich will nicht mehr aus Bequemlichkeit, Faulheit oder Konformismus Licht und Finsternis in mir zusammenleben lassen. Es ist eine sehr einfache Entscheidung, innerlich und konkret zugleich. … Wenn du die Welt nicht verändern kannst, kannst du dich selbst ändern. Wenn sich alle demütig dazu entschließen würden, würde das System der Lüge von selbst zusammenbrechen, denn seine einzige Stärke ist der Platz, den wir in ihm in uns schaffen. …
„Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, indem Gott uns den Glauben anbietet, öffnet er seine Hand, damit wir unsere Hand dorthin legen und uns von ihm leiten lassen. Wovor werden wir Angst haben? Das Wichtigste ist, dass wir unsere Hand fest in seiner halten! … Den Geist des Glaubens zu bewahren bedeutet, auf jeden Kompromiss zu verzichten, sich zu weigern, die Dinge anders als durch den Glauben zu sehen. Es bedeutet, unsere Hand in Gottes Hand zu halten. …
„Der Glaube erzeugt Kraft und Freude zugleich. Der Herr ist meine Festung, vor wem soll ich mich fürchten?“ (Ps 27,1) Die Kirche liegt im Sterben, verseucht von Bitterkeit und Parteilichkeit, und nur der Geist des Glaubens kann ein wahres brüderliches Wohlwollen begründen. Die Welt stirbt, verschlungen von Lügen und Rivalität, und nur der Geist des Glaubens kann ihr Frieden bringen.“
Walter Kardinal Brandmüller, der Anfang dieses Jahres seinen fünfundneunzigsten Geburtstag feierte, schrieb über das gleiche Problem – den Verlust des Glaubens in der Kirche –, wandte sich aber an seine deutschen Landsleute. Er stellte zunächst fest, dass der „Synodale Weg“ erwartungsgemäß „längst vom Weg abgekommen“ sei. Er beklagte die „achtlose Verschwendung“ von Millionen an Kirchensteuergeldern und, was „viel schlimmer“ sei, Meinungsverschiedenheiten in „zentralen Fragen des Glaubens und der Moral“, auch innerhalb des Episkopats, die der Einheit der gesamten Kirche „schweren Schaden“ zufügten und zu „Häresie und Schisma“ führten. Der Kardinal fügte zu dieser „Massenabtrünnigkeit“ hinzu und hob die Tatsache hervor, dass von den getauften Katholiken noch etwa fünf Prozent am religiösen, sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen.
„Wie lange noch?“, fragt der Kardinal, wird der Apparat seine Arbeit fortsetzen und dabei die Tatsache ignorieren, dass Millionen die Kirche verlassen, solange die Spendenbüchse voll ist. Er reflektiert über „den Erfolg des deutschen Wirtschaftswunders“ nach dem Zweiten Weltkrieg, der eine „immer dichter werdende Wolke des materialistischen Zeitgeistes“ mit sich brachte und „den Blick zum Himmel zu versperren begann“. Das Ergebnis der Flut materieller Güter ist „eine nachchristliche, atheistische Gesellschaft, in der das Christentum – die Kirche – nur ein Nischendasein fristet“, während es ignoriert, verachtet und bekämpft wird.
Der Kardinal reflektiert weiter, dass „eine nüchterne Bewertung schnell zeigt, dass die Versuche, die einstige Partnerschaft zwischen Staat, Gesellschaft und Kirche wiederzubeleben, längst aussichtslos geworden sind“.
„Die jüngste Gesetzgebung“, stellt er fest, „hat auch im Bereich der Ehe-, Familien- und Gesundheitspolitik Maßstäbe gesetzt, die die christliche Moral- und Soziallehre, ja die seit der Antike entwickelte Anthropologie ad absurdum führen.“ Er kommt zu dem Schluss, dass „kaum eine denkbare Perversion – von der In-vitro-Fertilisation über die Euthanasie bis hin zum assistierten Suizid – ausgeschlossen ist“.
Folglich müsse ein Christ, ein Katholik, „in dieser menschlichen, kulturellen Wüste Oasen finden und schaffen, in denen er noch frei atmen und überleben kann“. Der Kardinal erläutert den einzigen Weg, den er für möglich hält:
„So muss nun, je nach den gegebenen Umständen, der Übergang von der Landeskirche zur Gemeindekirche weitestgehend ohne schmerzhafte Unterbrechungen eingeleitet werden …
„Damit einher geht auch eine entschiedenere Betonung des Selbstverständnisses der Priester.“
Hier verweist der Kardinal auf den alten Weiheritus, in dem die Pflichten des Priesters aufgeführt waren: das heilige Opfer darzubringen, zu segnen, die Gemeinde zu leiten, zu predigen und zu taufen.
„Bezeichnend“, so Kardinal Brandmüller, „ist die Erwähnung der Pfarrverwaltung, der Ausschüsse, der Vermögensverwaltung und der Verwaltung sozialer Einrichtungen oder anderer Arbeiten nicht vorgesehen.“ Wie im Mittelalter ist auch heute noch die Liste der Pflichten, die im traditionellen Weiheritus festgelegt sind, die Arbeit, zu der der Priester geweiht ist.
Darüber hinaus müsse »diese Unterscheidung, die dem Priester nur die praeesse – den ›Vorsitz‹ oder die Leitung der Kongregation – vorbehält, vorgenommen werden, um dem Priester die Freiheit zu geben, seine eigentliche Sendung zu erfüllen: Verkündigung, Liturgie, Spendung der Sakramente und Seelsorge«, die von anderen nicht erfüllt werden kann.
Kardinal Brandmüller richtet seinen Blick auf die „Laien“ und fordert sie auf, auch ihrer eigenen Berufung zu folgen: „Ihr Verantwortungsbereich ist nicht die Kanzel und der Altar, sondern, wie das Zweite Vatikanische Konzil betont, ‚die Welt‘, in der die Kirche ihre Sendung zu erfüllen hat.“
„Eine solche Arbeitsteilung“, so der Kardinal, „ermöglicht es dem Priester, die notwendige Zeit für eine gewissenhafte Vorbereitung auf Predigten, Katechesen, pastorale Gespräche sowie für sein eigenes geistliches Leben zu gewinnen, solange die Mitarbeiter klug ausgewählt werden und gegenseitiges Vertrauen herrscht.“
Der Kardinal betont, dass „die Erfahrung zeigt, dass Laien und Priester die Grenzen ihrer Kompetenz nicht überschreiten dürfen“. Die Priester sollten „der Versuchung widerstehen, sich als Bauherren, Vermögensverwalter oder in anderen weltlichen Bereichen einen Namen zu machen“, während die Laien „Kanzel und Altar nicht als ihren ‚Arbeitsplatz‘ betrachten sollten“.
Abschließend äußert er die Hoffnung auf eine echte Komplementarität, die die Rolle des Klerus und der Laien gleichermaßen respektiert und auch heute ihre missionarische Wirkung unter Beweis stellt:
„Je mehr der gottlose Zeitgeist der Kirche ins Gesicht bläst, desto notwendiger wird eine enge Solidarität zwischen Gläubigen und Priestern. Vielleicht werden dann auch die ‚Heiden‘ von heute, wie sie es taten, in bezug auf die Christen sagen: ‚Seht, wie sie einander lieben.'“
„In der Tat“, sagt er, „könnten lebendige Gemeinschaften, wie Inseln im Meer, einen sicheren Hafen für Menschen bieten, die ziellos in den Wellen des Zeitgeistes treiben.“
Möge die Wahrheit der Äußerungen von Kardinal Sarah und Kardinal Brandmüller in der ganzen Welt widerhallen und Bischöfe, Priester und Laien über Kamerun und Deutschland hinaus erreichen. Ihre Stimme ist die Stimme der Nachfolger der Apostel, die zu ihren Herden spricht und jedem das gibt, was ihm gebührt, indem sie die Gerechten stärkt, die Entmutigten ermutigt und die Verlorenen auffordert, ihren Weg wiederzufinden. Möge es mehr solcher Stimmen geben!
Quelle: voice of the family